
YouTube - Kanal
der BUSE HERZ GRUNST Rechtsanwälte
Medienauftritte
der BUSE HERZ GRUNST Rechtsanwälte





Podcast - Anwaltsprechstunde
der BUSE HERZ GRUNST Rechtsanwälte
Medienauftritte






BUSE HERZ GRUNST Rechtsanwälte
Ihre Wirtschaftskanzlei in Berlin | Hamburg | München, bundesweit tätig.
Sie haben ein rechtliches Problem und sind auf der Suche nach kompetenten und lösungsorientierten Rechtsanwälten? Dann sind Sie bei der Kanzlei BUSE HERZ GRUNST Rechtsanwälte genau richtig.
Unsere Rechtsanwälte stehen Ihnen von Berlin, Hamburg und München aus in den Dezernaten Strafrecht, Medien- und Wirtschaftsrecht, Verkehrsrecht und Verwaltungsrecht deutschlandweit zur Seite. In welchen Fällen wir unsere Mandanten unterstützen, können Sie den jeweiligen Seiten unserer Website entnehmen.
Unsere Anwälte und Fachanwälte sind nahezu ausschließlich in festen Rechtsgebieten tätig. Wir sind Spezialisten und keine Generalisten, so dass wir eine hohe Expertise in den von uns angebotenen Bereichen garantieren können. Wir haben bereits mehrere tausend Verfahren bearbeitet, so dass unser Kanzleiteam äußerst praxis- und krisenerprobt ist. Diese Erfahrungen setzen wir jederzeit für unsere Mandanten und Mandantinnen ein. Die vielen positiven Rezensionen sowie Medienauftritte unserer Kanzlei zeigen, dass uns dies gelingt.
Unsere Rechtsgebiete
Erfahrung & Expertise für unsere Mandanten
Medien- & Wirtschaftsrecht
Medien- und Presserecht, Markenrecht, Urheberrecht, Wettbewerbsrecht, IT-Recht und mehr
Strafrecht
Sexualstrafrecht, Drogenstrafrecht, Wirtschaftsstrafrecht, Jugendstrafrecht und mehr
Verwaltungsrecht
Schulrecht, Hochschulrecht, Kindergartenrecht, Corona-Recht und mehr
Was unsere Kanzlei auszeichnet
Die hohe Qualität unserer Rechtsberatung hat für uns oberste Priorität. Diese stellen wir dadurch sicher, dass unsere Kanzlei Fachanwaltstitel in den Rechtsgebieten IT-Recht, Gewerblicher Rechtsschutz, Strafrecht und Urheber- und Medienrecht vorweisen kann. Fachanwaltstitel bedeuten nicht nur, dass besondere theoretische und praktische Kenntnisse in den jeweiligen Rechtsgebieten nachgewiesen wurden.
Vielmehr ist zur Aufrechterhaltung der Fachanwaltschaften eine stetige Fortbildung erforderlich, so dass wir mit der aktuellen Rechtsprechung und Gesetzesänderungen vertraut sind. Daneben sind mehrere Rechtsanwälte unserer Kanzlei an renommierten Hochschulen als Lehrbeauftragte tätig. Dies stellt ebenfalls sicher, dass die rechtswissenschaftlichen Grundlagen beherrscht und in verständlicher Form kommuniziert werden können.
Ihre Rechtsanwälte in Berlin, Hamburg und München.
Wir arbeiten im Team
Fachgebietsübergreifende Zusammenarbeit in allen Rechtsangelegenheiten
Wir verstehen uns als Teamplayer, sowohl innerhalb der Kanzlei als auch im Umgang mit Ihnen. Dies setzen wir sowohl in der Anwaltstätigkeit als auch im Sekretariat um, sodass Ihr Anliegen immer schnellstmöglich und effizient gelöst werden kann. Wir sind in Rechtsgebieten tätig, die häufig ein schnelles anwaltliches Handeln erfordern. Daher haben wir uns sachlich und personell so aufgestellt, dass wir dies für Sie zuverlässig gewährleisten können. In jedem Rechtsgebiet sind mindestens zwei Anwältinnen bzw. Anwälte tätig, so dass Ihnen jederzeit ein Ansprechpartner zur Verfügung steht. Wir verstehen uns als Krisenmanager, denn wir wissen, dass neben fundiertem Rechtsrat auch pragmatische Lösungsansätze erforderlich sind.

Unsere Mitgliedschaften
Zur Erhaltung unserer Expertise durch stetige Fortbildung sowie zur Pflege des Netzwerks aus Anwaltskolleg:innen sind die Anwält:innen unserer Kanzlei in Fachgesellschaften wie der GRUR (Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e. V.), der AGEM (Arbeitsgemeinschaft Geistiges Eigentum & Medienrecht im Deutschen Anwaltverein), der davit (Arbeitsgemeinschaft IT-Recht im Deutschen Anwaltverein) sowie der Vereinigung Berliner Strafverteidiger e.V. aktiv. Zudem bestehen Mitgliedschaften im Berliner Anwaltverein e.V. und im Deutschen Anwaltverein e.V. .



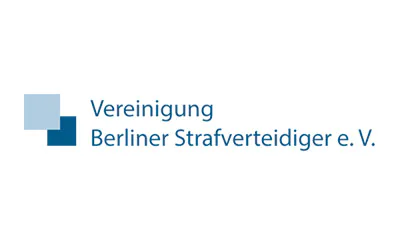




Unsere Standorte
in Berlin, Hamburg & München
Kontakt Standort:
BERLIN – KÖPENICK
Bahnhofstraße 17
12555 Berlin
Telefon: +49 30 51302682
Fax: +49 30 51304859
Nach Anklicken der Karte werden Sie zu Google Maps weitergeleitet und es gelten die Datenschutzbestimmungen von Google.
Kontakt Standort:
HAMBURG
Alter Wall 32
20457 Hamburg
Telefon: +49 40 8090319013
Fax: +49 40 8090319150
Nach Anklicken der Karte werden Sie zu Google Maps weitergeleitet und es gelten die Datenschutzbestimmungen von Google.
Kontakt Standort:
BERLIN – CHARLOTTENBURG
Kurfürstendamm 11
10719 Berlin
Telefon: +49 30 51302682
Fax: +49 30 51304859
Nach Anklicken der Karte werden Sie zu Google Maps weitergeleitet und es gelten die Datenschutzbestimmungen von Google.
Kontakt Standort:
MÜNCHEN
Antonienstraße 1
80802 München
Telefon: +49 89 74055200
Fax: +49 89 740552050
Kontakt aufnehmen
Wir helfen gerne
Nehmen Sie gern per Telefon oder per E-Mail Kontakt zu uns auf. Die freundlichen Mitarbeiter:innen im Sekretariat unserer Kanzlei nehmen Ihr Anliegen auf und vermitteln Sie an die passenden Anwält:innen. Von unseren Kanzleistandorten in Berlin (Kurfürstendamm und Köpenicker Bahnhofstraße), Hamburg (Alter Wall) und München (Antonienstraße) aus sind unsere Anwält:innen und Fachanwälte bundesweit für Sie tätig.








