Recht am eigenen Bild:
Wann wird ein Bildnis verletzt?
YouTube - Kanal
der BUSE HERZ GRUNST Rechtsanwälte
Podcast - Anwaltsprechstunde
der BUSE HERZ GRUNST Rechtsanwälte
Das Recht am eigenen Bild ist schneller verletzt als man denkt. Sowohl als Fotograf als auch als Abgebildeter sollten daher die Grundkenntnisse zum Bildnisrecht sitzen. Es kommt immer wieder vor, dass sowohl in der Presse als auch in den sozialen Medien Bildnisse bzw. Fotos veröffentlicht werden, obwohl es an einer Einwilligung der abgebildeten Person fehlt.
Dies stellt in vielen Fällen eine Persönlichkeitsrechtsverletzung dar, so dass den Betroffenen insbesondere Unterlassungsansprüche gemäß §§ 823 Abs. 1, 1004 BGB analog i.V.m. § 22 KUG zustehen. Auch können Ansprüche auf Schadensersatz oder Geldentschädigung entstehen.
■ IM VIDEO ERKLÄRT:
Recht am eigenen Bild: Wann ist eine Fotoveröffentlichung erlaubt?
Recht am eigenen Bild Paragraph
Aus dem grundgesetzlich verankerten allgemeinen Persönlichkeitsrechtsrecht der Art. 1 I, 2 I GG entspringt das Recht am eigenen Bild. Es handelt sich bei dieser Ausprägung um ein sogenanntes besonderes Persönlichkeitsrecht. Dieses gibt derjenigen Person, die abgebildet wird, das alleinige Recht, darüber zu entscheiden, ob und wie mit dem Bild verfahren und in wie weit es der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird. Damit trägt das Recht am eigenen Bild der Selbstbestimmung von Abgebildeten Rechnung.
§ 22 S. 1 KUG regelt, dass Bildnisse grundsätzlich nur mit der Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden dürfen. Die Rechtslage erkennt also die die Persönlichkeitsrechte bzw. Bildrechte von Abgebildeten als besonders schutzwürdig an. Dennoch werden immer wieder Fotos, auf denen Prominente sich ganz privat zeigen, ganz offensichtlich ohne deren Zustimmung veröffentlicht. Es muss also einige Ausnahmen geben. Damit steht das Recht am eigenen Bild nicht nur unter einem Zustimmungsvorbehalt, also dem Erfordernis der Einwilligung des Abgebildeten, sondern kann auch eingeschränkt werden.
Was wird durch das Recht am eigenen Bild geschützt?
Das Recht am eigenen Bild ist eine eher unglücklich Formulierung, da nicht einfach nur ein Bild per se geschützt wird, sondern vielmehr die Abbildung einer Person. Man spricht hier in Abgrenzung zum Bild von einem Bildnis und im Zuge dessen wegen der geläufigsten Darstellungsart in Form eines Fotos auch gern einmal vom sogenannten Fotorecht.
Dabei ist auch dieser Begriff irreführend. Denn das Recht am eigenen Bild schützt den Abgebildeten nicht nur im Rahmen von Fotos, sondern auch vor unzulässigen Darstellungen in anderen Kunstformen. Dazu zählen neben fotografischen Bildaufnahmen auch Werke wie Skulpturen, Gemälde, Karikaturen, Zeichnungen und ähnliche Abbildungen natürlicher Personen. Relevant ist hier einzig die Darstellung des Abgebildeten in seiner wirklichen, dem Leben entsprechenden Erscheinung. Wobei das Recht eigenen Bild gleichsam posthum und für Leichenfotos gilt.

Erkennbarkeit der abgebildeten Person
Um in den Schutzbereich des § 22 KUG zu fallen, genügt es nicht, dass die Person dargestellt ist. Sie muss zudem noch erkennbar, also identifizierbar, sein. Identifizierbarkeit ist hier aufgrund des persönlichkeitsrechtlichen Aspekts des Rechts am eigenen Bild weit auszulegen und nicht allein auf die Abbildung des Gesichts zu reduzieren.
Wichtig ist, dass die abgebildete Person für Dritte erkennbar sein muss. Dafür ist es ausreichend, wenn ein kleinerer Personenkreis aufgrund von bestimmten Merkmalen erkennen kann, um wen es sich konkret handelt. Ob der engere Freundes- und Familienkreis dahingehend ausreichend ist, wird kontrovers entschieden und wird, wie so oft, vom jeweiligen Einzelfall abhängen.
Oftmals können Personen anhand ihrer Gesichtszüge individualisiert werden. Aber auch Merkmale, die der Person typischerweise anhaften wie beispielsweise die Frisur, Statur oder Bekleidung können für die Erkennbarkeit ausreichen.
Ist keine Namensbezeichnung aufgeführt und führen die soeben genannten Kriterien nicht zur Erkennbarkeit der Person, könnte diese auch mithilfe sonstiger Umstände, z.B. die Kombination des Anfangsbuchstabens des Nachnamens mit dem Beruf, zu bejahen sein.
Die Verwendung schwarzer Balken über den Augen der Person ist nur dann zur Unkenntlichmachung geeignet, wenn keinesfalls eine Erkennbarkeit möglich ist. Zu schmale Balken oder zu schwache Verpixelungen des Gesichts führen oftmals zur Identifizierbarkeit der jeweiligen Person und reichen damit in der Regel nicht aus.
Daneben können situationsbedingte Begleitumstände eine Identifizierung des Abgebildeten ermöglichen.
Doubles und Look-Alikes
Abgebildete werden besonders oft in ihrem Recht am eigenen Bild verletzt, wenn es sich um die Kommerzialisierung von Bildnissen handelt. Dabei muss nicht immer die betroffene Person selbst abgebildet sein. Rechtsverletzungen können auch dann vorkommen, wenn Doubles und sogenannte Look-Alikes eingesetzt werden, die aufgrund ihrer oftmals verblüffenden Ähnlichkeit zu einer anderen Person deren Image auf das beworbene Produkt transferiert.

Recht am eigenen Bild Beispiele zu Doubles und Look-Alikes
Berühmte Fälle aus der Rechtsprechung sind hier unter anderem der Fall „Blauer Engel“, bei dem es um ein nachgestelltes Foto aus dem gleichnamigen Film ging, auf dem ein Double der zu diesem Zeitpunkt bereits verstorbenen Schauspielerin Marlene Dietrich eingesetzt wurde. Es wurde für die besondere Umweltfreundlichkeit eines PKW Modells geworben und statt des gleichnamigen Umweltsiegels das Bild mit dem Double für Werbezwecke eingesetzt.
Der BGH bestätigte ein posthumes Recht am eigenen Bild und die Möglichkeit der Verletzung durch ein Double. Außerdem wurde ein dahingehender Schadensersatzanspruch der Erben wegen der kommerziellen Nutzung bestätigt.
Ein aktuelleres Beispiel ist der Streit um Plakate zu der Tribute Show einer bekannten, mittlerweile ebenfalls verstorbenen, Sängerin. Hier wurden allerdings Plakat und Show in einem engeren sachlichen Zusammenhang gesehen, sodass nicht auf das kommerzielle Interesse abgestellt wurde, sondern auf die Kunstfreiheit.
Damit überwogen letztlich die Rechte der Showveranstalter und sie durften ohne Einwilligung der Klägerin veröffentlichen.
Durch welche Handlungen wird das Recht am eigenen Bild verletzt?
§ 22 KUG schützt die Abgebildeten vor der Verbreitung sowie vor der öffentlichen Zurschaustellung des Bildnisses.
In Anlehnung an § 17 I UrhG wird unter dem „Verbreiten“ das Anbieten oder das Inverkehrbringen des Originals oder des Vervielfältigungsstückes des Werkes in der Öffentlichkeit verstanden.
Das öffentliche Zurschaustellen liegt hingegen vor, wenn das Bildnis für andere wahrnehmbar ist. Das Wahrnehmbarmachen ist auf vielfältige Weise möglich. Meist wird dies durch die Medien geschehen. Social Media hat maßgeblich dafür gesorgt, dass die Verletzungen des Rechts am eigenen Bild der betroffenen Abgebildeten drastisch in die Höhe geschnellt ist. Das Smartphone ist schnell gezückt, man wollte eigentlich nur Selfies für Instagram und Co. machen und dort veröffentlichen.
Dass nun im Hintergrund bewusst oder unbewusst andere Menschen, teilweise Prominente, zu erkennen sind, und es sich damit auch um Personenfotos handelt, ist den meisten Nutzern in diesem Moment egal. Entscheidend ist die Verknüpfung mit der Öffentlichkeit, also dass das Bildnis für einen nicht abgrenzbaren Personenkreis der Öffentlichkeit bestimmt ist (vgl. § 15 III UrhG).
© sitthiphong – stock.adobe.com
Einwilligung der Abgebildeten: Wann darf ein Bildnis veröffentlicht werden?
Das Recht am eigenen Bild wird nicht verletzt, wenn der Abgebildete in die Verbreitung und öffentliche Zurschaustellung eingewilligt hat.
Die Einwilligung der Abgebildeten Person erfolgt regelmäßig gem. § 22 S. 1 KUG, sodass dann kein Verstoß gegen das Recht am eigenen Bild vorliegt. Das liegt daran, dass das Recht am eigenen Bild unter einem Einwilligungserfordernis steht. Die Einwilligung muss dabei nicht zwingend ausdrücklich, geschweige denn schriftlich, erfolgen.
Die Einwilligung kann grundsätzlich konkludent erfolgen, insbesondere dann, wenn der Abgebildete gem. § 22 S. 2 KUG eine Entlohnung erhalten hat.
Der § 22 S. 2 KUG stellt eine Vermutungsregelung auf. Danach soll die Einwilligung als erteilt gelten, wenn der Abgebildete dafür, dass er sich abbilden ließ, eine Entlohnung erhielt. Das Entgelt kann jeder Vorteil sein. Entscheidend ist, dass eine Gegenleistung, also eine Leistung, die konkret für das Abbilden erbracht wird, vorliegt. Aufgrund dessen, dass es sich lediglich um eine Vermutung handelt, ist diese widerlegbar.
Ansonsten muss für das Vorliegen einer konkludenten Einwilligung der abgebildeten Person klar sein, warum und in welchem Umfang die Veröffentlichung stattfinden soll.
In die Veröffentlichung des Bildnisses kann insofern dadurch eingewilligt werden, indem die Aufnahme an sich gebilligt wird und der Zweck bekannt ist. Voraussetzung ist also, dass seitens desjenigen, der die Veröffentlichung bezweckt, der Zweck und Umfang klar kommuniziert wird. Es macht beispielsweise einen sehr großen Unterschied, ob das Bild für die Veröffentlichung im Internet oder nur in Verbindung mit der Mitarbeiter-des-Monats-Tafel im Unternehmen verwendet wird.
Wenn Bildnisse in den sozialen Medien erscheinen, muss übrigens in den meisten Fällen von einer Erkennbarkeit ausgegangen werden, da über verknüpfte Konten und die Folter-Listen kaum Raum für Spekulationen übrig bleibt. Hier sollte also ganz genau hingesehen werden, ob man die Einwilligung, ob nun ausdrücklich oder konkludent, vor Veröffentlichung und dem Teilen eingeholt hat.
Ansonsten winkt schnell mal das Schreiben vom Anwalt, in welchem wegen der Verletzung des Rechts am eigenen Bild abgemahnt wird. Fehlen die oben genannten Punkte, scheidet eine konkludente Einwilligung vollends aus. Das einfache Hinnehmen der Aufnahme (Achtung: nicht der Veröffentlichung; hier würde man schnell in einer Duldung landen) reicht dafür nicht aus.

Wann darf ein Bildnis ohne Einwilligung veröffentlicht werden?
§ 23 KUG regelt die Ausnahmen des Einwilligungsgrundsatzes des § 22 KUG und enthält insofern Schranken des Bildnisschutzes. Danach dürfen ohne Einwilligung verbreitet oder zur Schau gestellt werden:
- Bildnisse aus dem Bereich der Zeitgeschichte,
- Bilder, auf denen die Person nur Beiwerk ist,
- Bilder, auf denen die Person an einer Versammlungen ö. ä. teilnimmt,
- Bildnisse, deren Verbreitung oder Schaustellung einem höheren Interesse der Kunst dient
Fotos machen und veröffentlichen erlaubt bei Ereignis der Zeitgeschichte
§ 23 I Nr. 1 KUG lässt die Veröffentlichung von Bildnissen „aus dem Bereich der Zeitgeschichte“ auch ohne Einwilligung des Abgebildeten zu. Der Begriff der Zeitgeschichte hat sich in den letzten Jahren signifikant geändert. Es fand eine Abkehr von der sogenannten personenbezogenen Betrachtungsweise bis hin zur ereignisbezogenen Betrachtungsweise.
Relative und absolute Personen der Zeitgeschichte
Die frühere Rechtsprechung ging davon aus, dass der Begriff der Zeitgeschichte auch an die auf dem Bild abgebildete Person anknüpft. Um innerhalb dieser Norm noch Wertungsspielraum zu haben, wurden die Kategorien der „Relativen Person der Zeitgeschichte“ sowie die der „Absoluten Person der Zeitgeschichte“ entwickelt. Der zeitgeschichtliche Kontext sollte sich aus dem Informationsinteresse der Allgemeinheit ergeben.
Dass auf jenes Interesse der Öffentlichkeit und dem Beitrag zur allgemeinen Willensbildung abgestellt wird, hat sich übrigens nicht geändert. Von einer absoluten Person der Zeitgeschichte ging man dann aus, wenn sie zu Lebzeiten schon derart herausstechen, dass sie im wahrsten Sinne des Wortes Geschichte schreiben und sogar post mortem noch von zeitgeschichtlicher Relevanz bleiben.
Mit dem letzten Punkt sollten die wenigen, welche nur vorübergehend interessant waren, davon ausgeschlossen werden. Bei sehr berühmten Vertretern aus den Bereichen der Kunst, Politik und dem Sport sowie bei Menschen, die durch ihre besonders aufsehenerregende Untaten relevant geworden waren, handelt es sich um absolute Personen der Zeitgeschichte.
Der Bildnisschutz ging bei diesen Personen, egal ob in Videos oder auf fotografischen Aufnahmen, praktisch gegen null. Man ging nämlich davon aus, dass eine permanente Bildberichterstattung in Bezug auf diese Personen immer und ausnahmslos von berechtigtem öffentlichen Interesse sei. Wer dazu Interesse hat, liest sich die berühmten Caroline-Urteile durch, welche wegweisend für das Recht am eigenen Bild waren.
Diejenigen, welche nur von vorübergehendem Interesse für die Allgemeinheit waren, wurden als relative Personen der Zeitgeschichte bezeichnet. Sie genossen einen vergleichsweise umfangreicheren Schutz und Bilder von ihnen konnten nicht immer veröffentlicht werden, ohne ihr besonderes Persönlichkeitsrecht zu verletzen.
Relative Personen der Zeitgeschichte waren nur kurz interessant, weshalb eine Bildberichterstattung hier nur im Rahmen dieses die vorübergehende Berühmtheit auslösenden Ereignisses zulässig war.
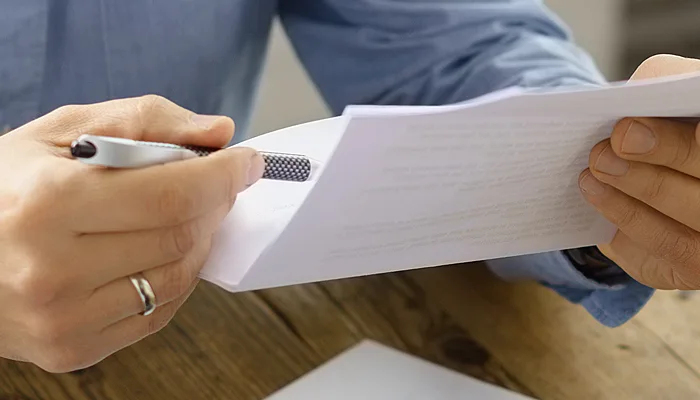
Zeitgeschichte als ereignisbezogenes Merkmal
Zeitgeschichte meint sämtliche Angelegenheiten, die von öffentlichem Interesse sind. Das bedeutet, alles, was die Öffentlichkeit interessiert und zur allgemeinen Willensbildung beiträgt. Man könnte sagen, dass die Öffentlichkeit die Zeitgeschichte bestimmt.
In seiner Entscheidung vom 24.06.2004 kippte der EGMR die bis dahin geltende Rspr. des BGH sowie des BVerfG zu den Personen der Zeitgeschichte. So wurde entschieden, dass bei der bloßen Veröffentlichung eines Bildnisses einer „bekannten“ Persönlichkeit in einer privaten Situation keine gesellschaftliche Relevanz vorliegt. Es fehlt dann an einem allgemeinen Interesse.
Obwohl die Personen der Zeitgeschichte keine Rollen mehr spielen, soll die relative Person der Zeitgeschichte eine Orientierungshilfe darstellen. Denn aus ihr geht hervor, dass es sich nicht zwingend um Personen des öffentlichen Lebens handeln muss, die durch bestimmte Ereignisse in das Blickfeld der Öffentlichkeit rücken können und somit Bildnisveröffentlichungen hinnehmen müssen.
Für vertraute Begleitpersonen, also in der Regel der Ehepartner oder Lebensgefährte, gilt Selbiges. Auch sie müssen je nach Situation die Veröffentlichungen von Fotos hinnehmen, wenn sie gemeinsam mit der bekannten Person in der Öffentlichkeit auftreten.
Insgesamt lässt sich also sagen, dass bekannte Personen nur dann in privaten Situationen abgelichtet werden dürfen, wenn ein Informationsinteresse der Öffentlichkeit besteht, was über die Abbildung als solche hinausgeht. Bei Privatpersonen gibt es hingegen enge Grenzen, denn sie genießen den größten Schutz. Für die Rechtmäßigkeit der Bildnisveröffentlichungen ist stets erforderlich, dass ein enger Zusammenhang mit einem zeitgeschichtlichen Ereignis besteht.
Es gibt keine strengen Regeln, an welche sich bei solchen Situationen gehalten werden kann. Denn wie so oft heißt es: Es hängt ganz vom Einzelfall ab. Damit ist gemeint, dass jedes mal eine individuelle Abwägung der kollidierenden Rechte (bspw. Presse- und Meinungsfreiheit versus Recht am eigenen Bild) und Interesse unter dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit vorgenommen werden muss.
Bilder erlaubt wenn Abgebildete nur nebensächlich
§ 23 I Nr. 2 KUG erlaubt Bildveröffentlichungen ohne Einwilligung, wenn die Person nur „Beiwerk“ neben einer Landschaft oder sonstigen Örtlichkeit ist. Ergibt sich aus dem Gesamteindruck des Bildes, dass nicht die Abbildung der Person im Vordergrund steht und die Personendarstellung auch nicht bezweckt wird, ist keine Einwilligung erforderlich. Würde man also die Person auf dem Bild austauschen oder wegnehmen können, ohne dass das Bild als solches seinen Charakter verlöre, ist dies durch § 23 KUG gedeckt.

Bilder von Versammlungen erlaubt?
§ 23 I Nr. 3 KUG erlaubt zudem die Veröffentlichung von Teilnehmern von Versammlungen, Aufzügen u.ä. Hier muss das Ereignis als solches im Vordergrund stehen und es muss ein öffentliches Ereignis sein. Zufällige Zusammentreffen reichen nicht aus. Die Person darf nicht im Vordergrund stehen, darf aber zwischen anderen Teilnehmern erkennbar sein. Letztlich zählt das Ereignis.
Höheres Interesse der Kunst rechtfertigt Bildaufnahme?
§ 23 I Nr. 4 KUG behandelt Bildnisse, die dem höheren Kunstinteresse dienen. Hierunter sollen ausnahmsweise auch Fotografien fallen. Problematisch kann es dann werden, wenn sich die Frage auftut, ob es sich um Kunst handelt und ob Kunst per se ein höheres Interesse darstellt oder innerhalb der Kunst es verschiedene Qualitätsabstufungen gibt. Da Letzteres gegen den Grundsatz spricht, dass Kunst keinen objektiven Wertungsmaßstäben unterliegt, kann davon ausgegangen werden, dass für Kunst ganz generell eine Ausnahme vom Einwilligungserfordernis bestehen kann. Auch hier gilt allerdings die Interessenabwägung nach den Grundsätzen der Verhältnismäßigkeit.
Satire als Kunstform
Interessant beim § 23 I Nr. 4 KUG ist die Einordnung von Satire, welche an sich zwar eine Kunstform darstellt. Wird diese Satire allerdings zu Werbezwecken verwendet, also um ein Produkt oder eine Dienstleistung durch den Imagetransfer und den mit der abgebildeten Person verbundenen Witz besser anzubieten, stellt sich die Frage nach dem Hauptmotiv. Ist es die Kunstfreiheit, die hier im Mittelpunkt steht oder das reine wirtschaftliche Interesse, zu deren Zweckerreichung sich lediglich des Mittels der Satire bedient wird? Auch diese Frage lässt sich nur im Einzelfall beantworten.
Foto: ©Door Coloures-Pic – stock.adobe.com
Verbreitung von Bildern doch wieder verboten bei Verletzung berechtigter Interessen
Zuletzt ist § 23 II KUG zu beachten. Danach erstreckt sich die Befugnis nicht auf eine Verbreitung und Schaustellung, durch die ein berechtigtes Interesse des Abgebildeten oder, falls dieser verstorben ist, seiner Angehörigen verletzt wird.
Mit dieser Rückausnahme werden Fälle geregelt, bei denen § 23 I KUG zwar vorliegt, eine Veröffentlichung jedoch wegen der Verletzung gesondert geschützter Interessen zu unterbleiben hat. Mit Berücksichtigung des § 23 II KUG ist dann auch das berühmte Modell der Stufentheorie im Recht am eigenen Bild vollständig. Die erste Stufe stellt § 22 KUG und das darin enthaltene Einwilligungserfordernis dar. Die zweite Stufe sind dann die in § 23 I KUG enthaltenen Ausnahmetatbestände. Die dritte Stufe stellt der § 23 II KUG und damit die Rückausnahme dar.
Unter das „berechtigte Interesse“ zählen unter anderem die Lebensbereiche nach dem Sphärenmodell. Danach nimmt der Schutz des Persönlichkeitsrechts immer weiter ab, je ferner sich der Sachverhalt vom Kernbereich privater Lebensgestaltung befindet.
Daher sind Bildberichterstattungen, bei denen die Kamera einen die Intimsphäre betreffenden Moment einfängt, in aller Regel unzulässig. Weniger Schutz erfahren Abgebildete, wenn es sich um einen die Privatsphäre betreffenden Sachverhalt handelt. Kaum geschützt sind schlussendlich Foto- oder Filmaufnahmen, die den Bereich der Sozialsphäre betreffen.
Ausnahmen vom Bildnisschutz zum Zweck der öffentlichen Sicherheit und Rechtspflege
Abgesehen von den im Alltag typischen Ausnahmen des § 23 I KUG, normiert § 24 KUG weitere Ausnahmen vom Recht am eigenen Bild bzw. dem Erfordernis der Einwilligung.
Demnach dürfen „für Zwecke der Rechtspflege und der öffentlichen Sicherheit“ Behörden die Bilder bzw. Bildnisse von Menschen vervielfältigt, verbreitet und öffentlich zur Schau gestellt werden, ohne dass eine Einwilligung eingeholt werden müsste.
Dabei ist es zwingend erforderlich, dass die Maßnahme durch eine Behörde durchgeführt wurde. Unter einer Behörde versteht man im juristischen Sinne eine Stelle, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnimmt. Das wird auch in § 1 BVwVfG legaldefiniert.
Klassischerweise werden unter der Ausnahme in § 24 KUG Bilder zum Zwecke der Strafverfolgung oder Fotos von vermissten Personen veröffentlicht. Die Fahndung von Straftätern ist hier eine besondere Fallkonstellation. Denn in § 24 KUG ist gewissermaßen die im Rahmen des § 23 II KUG erwähnte Interessen- und Güterabwägung bereits enthalten.
Ein zweiter Absatz zu den berechtigten Interessen der Abgebildeten fehlt hier und kann auch nicht aus § 23 II KUG einfach herangezogen werden. Es hat vielmehr bereits eine Abwägung stattgefunden: Der Gesetzgeber hat beschlossen, dass in diesen Fällen das Recht am eigenen Bild der abgebildeten Personen hinter dem Interesse der Allgemeinheit für die Verhinderung und Aufklärung von Verbrechen zurückstehen muss.
Dennoch dürfen keine Fotos von Personen veröffentlicht werden, die im Rahmen eines Bagatelldelikts gesucht werden. Das wäre dann nicht mehr im Sinne der Verhältnismäßigkeit und würde deren Recht am eigenen Bild verletzen.
© Collage D.Schmidt, SeanPavonePhoto – stock.adobe.com
Kann ich eine einmal erteilte Einwilligung wieder zurückziehen?
Eine einmal erteilte Einwilligung muss nicht für den Rest des Lebens oder sogar darüber hinaus gelten. Denn: Einwilligungen kann man widerrufen. Davon steht zwar nichts im KUG, aber wenn man sich den § 42 UrhG heranzieht, lässt sich daraus die Möglichkeit, eine Einwilligung aus wichtigem Grund zurückzurufen, analog herleiten.
Widerruf wegen Änderung der inneren Einstellung des Abgebildeten
Einmal kann die Einwilligung dann widerrufen werden, wenn sich die innere Einstellungen der abgebildeten Person geändert hat. Der Klassiker hier: Man ist in Jugendtagen mit der Veröffentlichung eines Party-Fotos einverstanden, möchte jedoch ein paar Jahre später einen seriösen Eindruck vermitteln. Da heutzutage potentielle Vorgesetzte gerne einmal den Bewerber googeln, ist dringend anzuraten, von diesem Recht auf Widerruf Gebrauch zu machen.
Widerruf der Erlaubnis zur Bildnisveröffentlichung aus wichtigem Grund
Daneben kann der Widerruf der Einwilligung in die Veröffentlichung, Verbreitung und Zurschaustellung von Fotos auch aus wichtigem Grund erfolgen. Der Begriff des „wichtigen Grunds“ ist nicht definiert und wird daher im Einzelfall ermittelt. Ein Beispiel aus der Rechtsprechung ging unter anderem davon aus, dass ein solcher Widerrufsgrund dann vorliegt, wenn die abgebildete Person aufgrund eines Fotos einem erheblichen „Shitstorm“ der Öffentlichkeit ausgesetzt ist (vgl. LG Köln, Urteil vom 14.08.2013, Az.: 28 O 62/13).
© LightFieldStudios – photodune.net
Verletzung des Rechts am eigenen Bild: Wann gibt es Geldentschädigung?
Wird das Recht am eigenen Bild verletzt, hat der Geschädigte in bestimmten Konstellationen die Möglichkeit, gegen den Verletzer Geldentschädigung zu verlangen.
Der Geldentschädigungsanspruch ergibt sich direkt aus Art. 2 I GG iVm Art. 1 I GG. Eine Geldentschädigung zum Ausgleich für erlittene Persönlichkeitsrechtsverletzungen kommt jedoch nur dann in Betracht, wenn eine schwerwiegende Persönlichkeitsrechtsverletzung vorliegt. Hinzukommt, dass sich die erlittene Beeinträchtigung nicht auf andere Weise ausgleichen lässt, so dass Befriedigung des Verletzten eintritt. Aufgrund der Schwere der Beeinträchtigung und des Fehlens anderweitiger Ausgleichsmöglichkeiten muss dabei ein unabwendbares Bedürfnis für einen finanziellen Ausgleich bestehen (BGH, NJW 1995, 861; BVerfG, NJW 1973, 1221).
Wann eine schwerwiegende Verletzung vorliegt, ist unter der Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls nach Art und Schwere der zugefügten Beeinträchtigung, der Bedeutung und Tragweite des Eingriffs, der Nachhaltigkeit und Fortdauer der Interessen- oder Rufschädigung des Verletzten, dem Grad des Verschuldens sowie nach dem Anlass und Beweggrund des Handelns des Verletzers zu betrachten, wobei schon ein einziger jener Umstände zur Schwere des Eingriffs führen (BGH, NJW 1996, 1131; BGH, NJW 2014, 2029; LG Köln vom 30.09.2015, Az.: 28 O 2/14, 28 O 7/14). Die pauschale Annahme des Vorliegens einer schwerwiegenden Verletzung in bestimmten Fallkonstellationen scheidet demnach aus. Es erfolgt stets eine Einzelfallprüfung, in der die vorgenannten Kriterien sorgfältig zu durchdenken und auf den jeweiligen Fall anzupassen sind.
Liegen anderweitige Ausgleichsmöglichkeiten vor, scheidet ein Anspruch aus. Dem Geldentschädigungsanspruch kommt insofern eine Art Auffangfunktion zu. Bildnisschutzverletzungen stellen oftmals sogar einen Eingriff in die Intimsphäre des Verletzten dar. Bereits bei Verletzungen der Privatsphäre sind anderweitige Ausgleichsmöglichkeiten äußerst fraglich. Denn in diese Sphären wurde eingegriffen, die Sphären wurden geöffnet. Der Geldentschädigungsanspruch füllt demnach bestehende Lücken, deren Vorliegen andernfalls für den Verletzten die Gefahr mit sich bringt, bei Persönlichkeitsrechtsverletzungen rechtsschutzlos zu sein. Auch dient er der Abschreckung, da andernfalls die verletzende Person sich lediglich einem Unterlassungsanspruch ausgesetzt sehen würde.
Weiter ist erforderlich, dass ein unabwendbares Bedürfnis für den Ausgleich vorliegt. Ein unabwendbares Bedürfnis liegt vor, wenn sich im Rahmen der vorzunehmenden Gesamtabwägung aller maßgeblicher Umstände des Einzelfalles der Angriff gegen die Grundlagen der Persönlichkeit richtet, das Schamgefühl durch die Persönlichkeitsverletzung berührt ist sowie wenn sie ein Gefühl des Ausgeliefertseins verursacht (LG Köln; Urt. v. 10.10.2012; Az.: 28 O 195/12; vgl. Burkhardt in Wenzel, Das Recht der Wort- und Bildberichterstattung, 5. Auflag, Kap. 14.128).
Es kommt insofern nicht nur auf die Schwere des Eingriffs an. Es ist immer eine Einzelfallprüfung vorzunehmen, in der die Gesamtumstände berücksichtigt werden. Die Zweckbestimmung des Entschädigungsanspruches, die „Lückenfüllerfunktion“, sollte dabei niemals außer Acht gelassen werden.
In welcher Höhe der Anspruch zugesprochen wird, hängt von einigen Faktoren ab. So sind z.B. der durch die Verletzung erzielte Gewinn des Verletzers sowie die Tragweite der Verletzung beeinflussende Faktoren. Bei der Berechnung der Höhe geht es darum, dem Verletzer zu verdeutlichen, sein Handeln zukünftig sorgfältiger zu durchdenken. Andererseits ist nicht zu verkennen, dass die Pressefreiheit ebenso grundgesetzlich verankert ist und in diese nur in verhältnismäßiger Weise eingegriffen werden darf. Die konkrete Verletzung des Verletzten ist in die Überlegungen ebenso einzubeziehen.
Die Geldentschädigung wegen einer Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts dient insoweit zum einen der Genugtuung des Opfers und zum anderen der Prävention (BGH NJW 1996, 985, 987 – Kumulationsgedanke).

Ist die Verletzung des Rechts am eigenen Bild eine Straftat nach STGB?
Tatsächlich kann die Verletzung des Rechts am eigenen Bild sogar eine Straftat darstellen, sodass eine Geldstrafe oder gar eine Freiheitsstrafe drohen kann. Im StGB sanktioniert zum Beispiel § 201a StGB die Verletzung des höchtpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen. Primär wird die Verletzung des Rechts am eigenen Bild nach § 33 KUG bestraft. Das Verbreiten oder öffentlich zur Schau Stellen eines Bildnisses entgegen den Vorgaben der §§ 22, 23 KUG (also insbesondere ohne erforderliche Einwilligung) wird hiernach mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit einer Geldstrafe bedroht.
Recht am eigenen Bild Arbeitnehmer – Wann dürfen Arbeitgeber Fotos von Arbeitnehmern verwenden?
Eine Website, in der das Team – auch mit Fotos – vorgestellt wird sowie oftmals auch ein social media Auftritt, ist inzwischen keine Seltenheit mehr. Aber darf der Arbeitgeber Fotos von Mitarbeitern veröffentlichen? Kann der Arbeitnehmer die Veröffentlichung von Fotos untersagen? Muss der Arbeitgeber Mitarbeiterfotos löschen, wenn der Mitarbeiter kündigt?
Einwilligung Fotos Arbeitnehmer – wie setze ich eine Einwilligungserklärung auf?
Spricht man von einem Vertrag über die Datenverarbeitung in Form von Bildnisveröffentlichungen, ist damit nicht der Arbeitsvertrag gemeint. Dies würde gegen den Grundsatz verstoßen, dass eine Einwilligung in die Datenverarbeitung stets freiwillig erfolgen muss. Würde diese nun aber Bestandteil des Arbeitsvertrages sein, käme der Arbeitnehmer in eine Zwangslage, in der er sich zwischen Datenverarbeitung und Job entscheiden müsste. – Was ihm letztlich keine richtige Wahl lässt. Daher: Entweder einen extra Vertrag aufsetzen, nach welchem der Arbeitnehmer für seine Einwilligung in die Datenverarbeitung entschädigt wird oder eine einfache Einwilligungserklärung vorformulieren und unterschreiben lassen. Für beide Varianten gelten gleiche Grundregeln, die man in Art. 4 Nr. 11, Art. 5 und Art. 7 DSGVO findet:
- Die Einwilligung in das Anfertigen von Aufnahmen muss schriftlich erfolgen und es muss sofort klar sein, dass es sich um eine solche handelt. Am besten integriert man das Wort „Einwilligungserklärung“ in die Überschrift des Dokuments.
- Die Einwilligung wird freiwillig erteilt. Es darf die Einwilligung nicht an die Erfüllung des Arbeitsvertrages gekoppelt sein (Koppelungsverbot).
- Die Einwilligung muss unmissverständlich, aktiv und eindeutig bestätigend abgegeben worden sein.
- Verständliche Formulierungen, einfache Sprache!
- Unmissverständliche Aufzählung der konkreten Verarbeitungssituationen.
- Informationen wie Speicherdauer und die Benennung der zur Verarbeitung berechtigten Personen gehören ebenso in die Einwilligungserklärung.
- Zweckgebundene Datenverarbeitung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b DSGVO: Die Bildnisse dürfen nur „für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden und dürfen nicht in einer mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise weiterverarbeitet werden (…)“.
© Halfpoint – Fotolia
Arbeitgeber Fotos Mitarbeiter Webseite Einwilligung erteilt – Darf ich Mitarbeiterfotos auch auf social media posten?
Die Einwilligungserklärung muss die Verarbeitungssituationen konkret benennen. Wurde in die Bildnisveröffentlichung „im Internet“ eingewilligt und es existiert eine Homepage, kann es zu nachvollziehbaren Missverständnissen in Bezug auf die vom Arbeitgeber intendierten und die vom Arbeitnehmer angenommenen Verarbeitungssituationen kommen. Daher gilt besonders bei gewünschten Uploads von Mitarbeiterfotos in Social Media (auch der Firmenchat auf WhatsApp zählt dazu!) die Empfehlung, die Plattformen konkret zu benennen. Im Übrigen gilt in Bezug auf WhatsApp o.ä. Dienstleister die Notwendigkeit einer weiteren Einwilligungserklärung in die Datenverarbeitung im Sinne von „Teilen der privaten Rufnummer der Mitarbeiter in unternehmensinternen Chatgruppen“.
Fotoveröffentlichung auf Firmenveranstaltungen – Darf ich als Arbeitgeber ein Bild der Weihnachtsfeier auf social media posten?
Stellt man auf § 23 Abs. 1 Nr. 1 KUG ab, handelt es sich ggf. um ein zeitgeschichtliches Ereignis und es bedarf keiner Einwilligung. Stellt man auf Art. 6, 88 DSGVO ab, kann hier kaum eine Erforderlichkeit der Datenverarbeitung angenommen werden, welche eine Einwilligung entbehrlich machen würde. Denn das Interesse des Arbeitgebers an der Veröffentlichung auf Social Media wird nicht höher eingestuft als der Datenschutz des Arbeitnehmers. Also das Gruppenbild von der Weihnachtsfeier auf Instagram ist nach KUG okay, aber nach DSGVO nicht.
Dieses ambivalente Ergebnis dürfte so nicht auftauchen. Denn die konkurrierenden Interessen sind dieselben. Auch die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit innerhalb einer Güter- und Interessenabwägung sind dieselben.
Die Lösung: Es sollte entweder eine Einwilligung oder ein Vertrag für die Bildnisverwertung im Beschäftigungskontext vorbereitet und unterschrieben werden.
Muss der Arbeitgeber Mitarbeiterfotos löschen, wenn der Mitarbeiter kündigt? Recht am eigenen Bild Arbeitnehmer
Das kommt auf das konkrete Bild an. Ein Foto, das den Arbeitnehmer individuell darstellt (z.B. ein Mitarbeiterprofil auf der Website) muss nach der Kündigung gelöscht werden. Anders kann es sich verhalten, wenn es sich um z.B. Werbefotos handelt, bei denen nicht der Arbeitnehmer individuell im Vordergrund steht bzw. dargestellt wird.

Recht am eigenen Bild Promis – Darf man Promis fotografieren? Welche Rechte haben Prominente bei der Veröffentlichung ihrer Bilder?
Auch Promis steht selbstverständlich ein Recht am eigenen Bild zu, woraus ein entsprechender Bildnisschutz resultiert. Dieser kann unter Umständen aber eingeschränkt sein und muss je nach Konstellation im Rahmen einer Abwägungsentscheidung hinter dem öffentlichen Informationsinteresse zurücktreten.
Verwerter fremder Bildaufnahmen oder anderer Bildnisse müssen sich vor der geplanten Veröffentlichung einer solchen Einwilligung ernsthaft vergewissern. Tun sie dies nicht, verletzten sie die ihnen obliegenden Sorgfaltspflichten und machen sich unter Umständen haftbar. Was dabei im Einzelnen von ihnen verlangt werden kann, ist nicht von vornherein festgeschrieben, sondern orientiert sich insbesondere an der Intensität der von der Veröffentlichung ausgehenden Beeinträchtigung.
Am Rande sei nur erwähnt, dass in Zweifelskonstellationen vom Vorliegen einer Einwilligung ausgegangen wird, wenn der Abgebildete für die Erstellung des Bildnisses entlohnt wurde.
Wann dürfen Fotos von Prominenten ohne Einwilligung veröffentlicht werden?
Nach § 23 Abs.1 Nr.1 KUG dürfen unter anderem Bildnisse aus dem Bereich der Zeitgeschichte ohne Einwilligung des Betroffenen verbreitet und öffentlich zur Schau gestellt.
Es wird auch hinsichtlich der Veröffentlichung von Fotos von Promis heutzutage eine Abwägung vorgenommen: Eine Abwägung zwischen dem Persönlichkeitsrecht des Prominenten (in Gestalt des Rechts am eigenen Bild) und dem Informationsinteresse der Öffentlichkeit.
Entscheidendes Kriterium ist dabei der Informationswert. Je größer der Informationswert für die Öffentlichkeit ist, desto mehr muss das Schutzinteresse desjenigen, über den informiert wird, hinter den Informationsbelangen der Öffentlichkeit zurücktreten. Umgekehrt wiegt aber auch der Schutz der Persönlichkeit des Betroffenen desto schwerer, je geringer der Informationswert für die Allgemeinheit ist. Das Interesse der Leser an bloßer Unterhaltung hat gegenüber dem Schutz der Privatsphäre regelmäßig ein geringeres Gewicht und ist nicht schützenswert (vgl. BGH, NJW 2007, 1977).
Ob noch ein zulässiger Bezug des Bildnisses zur Berichterstattung besteht, kann daher im Einzelfall äußerst problematisch zu beurteilen sein. Hier kommt es oft darauf an, einen umfassenden Überblick der kasuistisch geprägten Rechtsprechung zu haben und die Feinheiten bzw. Unterschiede sorgsam herauszuarbeiten.
Dies gilt beispielweise für die Veröffentlichung von Urlaubsfotos. Es gilt sodann aus anwaltlicher Sicht, die maßgeblichen Argumente vorzutragen, um das Persönlichkeitsrecht des Betroffenen durchzusetzen.
Kann ein Verstoß gegen § 22 KUG und damit ein rechtswidriger Eingriff in das Persönlichkeitsrecht festgestellt werden, ist dieser nicht schutzlos gestellt. So kommen beispielsweise Ansprüche auf Unterlassung, materiellen Schadensersatz oder Geldentschädigung in Betracht.

Recht am eigenen Bild Kinder: Welche Rechte haben Eltern und Kinder bei der Veröffentlichung von Kinderfotos?
Nach gefestigter Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes (BVerfG) umfasst der Schutzbereich des allgemeinen Persönlichkeitsrechts auch die Beziehungen von Eltern zu ihren Kindern (vgl. BVerfG, NJW 2008, 39 ff.). Kinder bedürften zudem von Natur aus eines besonderen Schutzes.
Wie im Äußerungsrecht üblich, müssen die widerstreitenden Interessen gegenübergestellt und gegeneinander abgewogen werden. Dabei ist auch auf die Art und Weise der Berichterstattung und die sonstigen Begleitumstände einzugehen.
Suchen Eltern samt Kind beispielwiese vermehrt die Öffentlichkeit unter Zuhilfenahme der Medien, ist das ein entscheidender Gesichtspunkt, der im Rahmen der Abwägungsentscheidung negativ gewertet werden kann. Wird über Tatsachen berichtet, kommt es entscheidend auf deren Wahrheitsgehalt an. Beleidigende Äußerungen, Anprangerungen oder Schmähkritik müssen nicht hingenommen werden. Ob eine der zuvor genannten Kriterien einschlägig ist, ist natürlich immer eine Frage, die anhand des Einzelfalls und der konkreten Umstände zu überprüfen ist.
Dürfen Fotos von Kindern ohne Zustimmung veröffentlicht werden? Wann dürfen Fotos von Kindern in sozialen Medien veröffentlicht werden?
Auch für Kinder gilt das Kunsturhebergesetz und damit das Erfordernis einer Einwilligung in die Bildnisverarbeitung.
Welche Rechte haben Eltern bei der Veröffentlichung von Kinderbildern?
Einwilligungsberechtigt sind prinzipiell die Eltern als gesetzliche Vertreter. Hat der Minderjährige jedoch die nötige Einsichtsfähigkeit selbst erlangt (in der Regel ab 14 Jahren), kommt es nach dem BGH zu einer sogenannten Doppelzuständigkeit (vgl. BGH, GRUR 2005, 74 (75)). Im Ergebnis müssen daher sowohl der Minderjährige als auch seine Eltern in die Veröffentlichung einwilligen, insbesondere darf sich nicht ohne Weiteres über die verweigerte Zustimmung des Minderjährigen hinweggesetzt werden.
Kann eine solche Einwilligung nicht festgestellt werden, stellt dies gewöhnlich einen rechtswidrigen Eingriff in das Recht am eigenen Bild dar.

Presseberichterstattung Sportler: Welche Rechte haben Sportler bei der Verwendung ihrer Bilder?
Berichterstattungen unterfallen in erster Linie der Meinungs- und Pressefreiheit des Art. 5 GG und genießen einen starken verfassungsrechtlichen Schutz. Medien sollen grundsätzlich uneingeschränkt berichten und die Öffentlichkeit informieren dürfen.
Immer dann, wenn von der Äußerung aber auch unmittelbar Individuen betroffen sind, müssen deren Rechte hinreichend Beachtung finden. Dies gilt beispielsweise für die Äußerung nachweislich unwahrer Tatsachen oder für die Preisgabe sensibler Daten, die dem absoluten Kernbereich des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, der sogenannten Intimsphäre zuzuordnen sind.
Und auch bei Presseberichterstattung über Sportler wird wieder eine Abwägung zwischen den kollidierenden Interessen im konkreten Einzelfall vorgenommen. Besonders hohe Anforderungen an ein hinreichendes öffentliches Interesse bestehen aber nicht. Stellen die Medien einzelne Sportler oder Sportlerinnen identifizierend im Zusammenhang mit einem sportlichen Ereignis in den Vordergrund, begründet dies regelmäßig ein öffentliches Interesse und rechtfertigt eine Berichterstattung, wobei es natürlich immer auf die Art der Veranstaltung und deren Ausmaße ankommen wird.
Ist eine solche Zugehörigkeit nicht mehr feststellbar, wird die Bejahung eines öffentlichen Interesses schon schwieriger. Häufig wird nun die Frage nach dem sonstigen Bekanntheitsgrad des Sportlers oder der Sportlerin eine Rolle spielen und in welcher Sphäre bzw. Intensität das allgemeine Persönlichkeitsrecht betroffen ist.
Im Falle des bekannten Formel 1 Fahrers „Michael Schuhmacher“ entschied der BGH beispielsweise, dass Äußerungen über den konkreten Gesundheitszustand und insbesondere eine „plagative Schilderung konkreter gravierender Einschränkungen“ nicht von einem berechtigten Informationsinteresse der Öffentlichkeit gedeckt und somit unzulässig sind (vgl. BGH, GRUR 2017, 304 (307)).
Berichterstattung bei Dopingvorwürfen Sportler – was darf die Presse?
Vor allem in Zusammenhang mit Ausdauersportarten wie dem Radsport, Skilanglauf oder der Leichtathletik, finden sich immer wieder Berichterstattungen, in welchen sich identifizierend über Dopingverdächtigungen geäußert wird. Diese können gerade bei Berufssportlern einen gravierenden Einfluss auf ihr Image und den weiteren Verlauf ihrer sportlichen Karriere haben und sind daher als schwerwiegender Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht einzustufen.
Was ist bei der Veröffentlichung von Sportlerbildern in den Medien zu beachten? Wann dürfen Sportlerfotos ohne Zustimmung verwendet werden?
Im Ergebnis dreht sich auch beim Bildnisschutz von Sportlern alles um eine Abwägung zwischen den tangierten Interessen und den sich dahinter verbergenden Grundrechten.
Nur ausnahmsweise dürfen Bildnisse der Abgebildeten ohne deren Einwilligung gemäß § 23 Abs. 1 KUG verbreitet und zur Schau gestellt werden. Die Veröffentlichungen der Medien müssen auch hier einem Informationsinteresse der Öffentlichkeit dienlich sein. Wie dieses konkret gestaltet ist, können die Medien grundsätzlich autonom beurteilen. Es ist jedoch zu beachten, dass das Informationsinteresse der Öffentlichkeit immer in Zusammenspiel mit dem Eingriff in die Rechte des Betroffenen zu bewerten ist. In der Konsequenz bedeutet dies, dass beispielsweise ein intensiver Eingriff in die Privatsphäre des Betroffenen durch ein gewichtiges öffentliches Informationsinteresse gedeckt sein muss.
© Stadtrandfoto – stock.adobe.com
Werden Abbildungen bzw. Bilder veröffentlicht, ist stets zu prüfen, ob dies hinzunehmen ist. Liegt weder eine konkrete noch eine konkludente Einwilligung vor, ist zu prüfen, ob diese überhaupt zwingend erforderlich ist. Es könnte eine Ausnahme nach § 23 KUG vorliegen, wonach Abbildungen bestimmter Bereiche auch ohne Einwilligung gestattet sind (auch § 24 KUG enthält Ausnahmen).
Vor allem im Rahmen der Prüfung des § 23 I Nr. 1 KUG ist sorgfältig abzuwägen, ob das Interesse des Abgebildeten oder die Meinungs- und Pressefreiheit überwiegt. Zudem darf nicht außer Acht gelassen werden, dass trotz des Vorliegens der Voraussetzungen eine Veröffentlichung nicht erfolgen darf, wenn berechtigte Interessen verletzt werden.
Aufgrund der erhöhten Komplexität, sich gefestigten falschen Vorstellungen von erlaubten Bildnisveröffentlichungen und der durch die sozialen Medien bzw. digitalen Möglichkeiten des Internets gesteigerten Relevanz, ist zum Thema Bildnisschutz und Persönlichkeitsrechte dringend zu empfehlen, sich Unterstützung vom Anwalt für Medienrecht und Presserecht zu suchen.
Unsere Kanzlei mit dem Schwerpunkt Medien-, Presse– und Persönlichkeitsrecht steht sowohl Betroffenen als auch Medien oder Privatpersonen, welche Fotos in unzulässiger Weise verbreitet haben, bundesweit jederzeit gern zur Verfügung.
Nehmen Sie jetzt Kontakt zum Anwalt Ihres Vertrauens auf
Wenden Sie sich für weitere Fragen gerne an unsere Kanzlei und vereinbaren Sie einen Beratungstermin per Telefon, per Videoanruf oder direkt vor Ort. Wir stehen Ihnen effizient mit jahrelanger Expertise zur Verfügung.
















