Einstellungsmöglichkeiten des Strafverfahrens
im Jugendstrafrecht
YouTube - Kanal
der BUSE HERZ GRUNST Rechtsanwälte
Podcast - Anwaltsprechstunde
der BUSE HERZ GRUNST Rechtsanwälte
Wann kann ein Strafverfahren gegen Jugendlichen eingestellt werden? Ist eine Einstellung oder ein Freispruch besser? Was sind die Folgen einer Einstellung?
Schnell zum Inhalt:
Im Ermittlungsverfahren und nach Ansprache in der Hauptverhandlung kann es als Rechtsanwalt für Jugendstrafrecht sinnvoll sein, auf eine Einstellung des Jugendstrafverfahrens hinzuwirken.
Unsere Kanzlei, insbesondere auch das Strafrechtsdezernat, kann durch unsere lebensnahe Ausrichtung und großartige Zusammenarbeit seit Jahren auf eine Vielzahl erfolgreich abgeschlossene Verfahren und herausragende Bewertungen durch unsere Mandanten zurückblicken. Entscheidend dabei sind nicht nur unsere transparenten Preise und kompetente Beratungen zum frühestmöglichen Zeitpunkt im Verfahren, sondern auch unser offener, aber vertrauensvoller Umgang im Mandantenkontakt. Wir sind in allen Dezernaten sehr drauf bedacht, dass Ihre Anliegen unvoreingenommen Gehör finden und wir ständig für Sie erreichbar sind. Wir sehen es als unsere Aufgabe, Sie nicht nur fachkundig, sondern auch persönlich bestmöglich zu vertreten.
Als Fachanwälte für Strafrecht ist es unser primäres Ziel auf eine Verfahrenseinstellung hinzuwirken. Unabhängig von Schuld oder Unschuld stehen wir im Jugendstrafrecht an Ihrer Seite. Rufen Sie uns gerne an und vereinbaren einen persönlichen Termin. Es ist wichtig, an dieser Stelle nicht zu zögern, schließlich geht es um die persönliche und berufliche Zukunft Ihres Kindes. Vermeiden Sie unüberlegte Schritte und damit vielleicht entscheidende Fehler, die sich negativ auf das Strafverfahren auswirken können. Es gilt dabei natürlich, desto früher Sie sich an uns wenden, desto gezielter und effektiver können wir die Verteidigung umsetzen. Als Fachanwaltskanzlei für Strafrecht in Berlin betreuen wir Sie erfahren, kompetent und engagiert im Jugendstrafrecht.
Wann sollten Sie uns als Anwälte für Jugendstrafrecht beauftragen?
Es gilt der Grundsatz je eher Sie uns im Verfahren beauftragen, desto besser sind die Chancen für die Strafverteidigung. Spätestens mit Erhalt einer Vorladung oder eines Äußerungsbogen durch die Polizei sollten Sie sich an einen Anwalt für Jugendstrafrecht wenden. Als Beschuldigter einer Straftat besteht das Schweigerecht bei Jugendlichen und Heranwachsenden genau wie bei Erwachsenen. Sie sollten von Ihrem Schweigerecht Gebrauch machen, dann kann der Rechtsanwalt für Sie die optimale Verteidigung entwickeln.
In unserer Praxis wird uns häufig berichtet, dass Polizeibeamte und Mitarbeiter des Jugendamtes aktiv von der anwaltlichen Vertretung im Strafverfahren abraten. Diese Hinweise sollte man sehr kritisch betrachten. Die Ermittlungsbehörde möchte „den Täter überführen“ und hat keine Entscheidungskompetenz für die weitere Entwicklung des Verfahrens. Ob ein Verfahren eingestellt oder angeklagt wird, entscheidet die Staatsanwaltschaft und nicht der Vernehmungsbeamte. Ein Rechtsanwalt stört die Polizeibeamten nur bei der Überführung der Jugendlichen.
Ob ich einen Anwalt für Jugendstrafrecht beauftragen sollte, ist unabhängig von Schuld oder Unschuld. Gerade im Jugendstrafrecht sollte man nicht auf den Ansatz vertrauen – „Wenn ich nichts getan habe, kann auch nichts passieren“. Das Jugendstrafrecht ist geprägt vom Erziehungsgedanken. Die Staatsanwaltschaft und auch die Gerichte konzentrieren sich ohne gezielte Strafverteidigung mehr auf die Straffolgen als auf die Aufklärung, was nun tatsächlich passiert ist.
Insbesondere in den folgenden Situationen sind wir als Anwälte für Jugendstrafrecht für Sie da:
- Vorladung als Beschuldigter von der Polizei oder Staatsanwaltschaft mit dem Vorwurf einer Straftat im Jugendstrafrecht
- Hausdurchsuchung durch die Ermittlungsbehörde im Bereich des Jugendstrafrechts
- Untersuchungshaft / Festnahme wegen des Verdachts einer Straftat
- Pflichtverteidigung für Jugendliche und Heranwachsende
- Anklage der Staatsanwaltschaft in Jugendsachen
- Ladung zu einem Jugendgerichtstermin vor dem Amtsgericht oder Landgericht
- Rechtsmittel – Berufung und Revision nach einer Verurteilung vor einem Jugendgericht
Termine für eine rechtsanwaltliche Beratung können in Berlin-Köpenick und Berlin-Charlottenburg vereinbart werden. Im ersten Schritt wird meist zusammen mit den Eltern eine Erstberatung mit dem Rechtsanwalt vereinbart. In dieser können die Vorwürfe meist schon grob bewertet und der allgemeine Ablauf eines Verfahrens besprochen werden. Auf viele der dringlichsten Fragen kann bereits zu einem frühen Zeitpunkt eingegangen werden, was zur Beruhigung der Eltern und des Jugendlichen führt. Im nächsten Schritt wird Akteneinsicht in die Ermittlungsakte beantragt. Nach Zusendung der Akte können die Verteidigungsmöglichkeiten und drohende Strafhöhe eingeschätzt werden. Im Jugendstrafrecht sind viele Besonderheiten zu beachten, die ich als Rechtsanwalt für Jugendstrafrecht genau im Blick habe.
Die Strafverteidigung und das Ziel der Verfahrenseinstellung
Je schneller ein Strafverfahren ohne negativen Folgen für den Mandanten beendet werden kann, desto besser. Auch und gerade im Jugendstrafverfahren gibt es die Möglichkeit, dass die Staatsanwaltschaft von der Verfolgung des Täters absieht.
Unsere Kanzlei für Jugendstrafrecht beginnt daher bereits im Ermittlungsverfahren mit der effektiven Strafverteidigung, um das Verfahren möglichst schnell zu beenden.
Welche Arten der Verfahrenseinstellung gibt es im Strafrecht?
Das deutsche Strafprozessrecht kennt verschiedene Arten der Verfahrenseinstellung. Gem. § 170 Abs.2 StPO ist das Strafverfahren zum Beispiel einzustellen, wenn die Staatsanwaltschaft nach Abschluss der Ermittlungen einen hinreichenden Tatverdacht nicht bejahen kann. Dies gilt unabhängig davon, ob Jugend- oder Erwachsenenstrafrecht Anwendung findet.
Was bedeutet hinreichender Tatverdacht?
Hinreichender Tatverdacht ist stets nur dann gegeben, wenn die Verurteilung wegen einer Straftat wahrscheinlicher ist als ein Freispruch.
Einstellung des Jugendstrafverfahrens beim Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz
Bei dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz z.B. durch den Besitz von Cannabis kann die Staatsanwaltschaft nach § 31a BtMG ebenfalls von der Verfolgung absehen, wenn die Schuld des Täters als gering anzusehen wäre, kein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung besteht und der Täter die Betäubungsmittel lediglich zum Eigenverbrauch besessen hat.
Was ist eine Verfahrenseinstellung aus Opporunitätsgründen?
Darüber hinaus darf die Staatsanwaltschaft unter bestimmten Voraussetzungen trotz an sich bestehender Verfolgungsvoraussetzungen von der Verfolgung absehen. Man spricht dabei von der Verfahrenseinstellung aus Opportunitätsgründen (BeckOK StPO/Beukelmann, 33.Ed. 1.4.2019, StPO § 152 Rn. 3.). Diese Form der Verfahrenseinstellung richtet sich
- im Erwachsenenstrafrecht nach den §§ 153 ff. StPO
- im Jugendstrafrecht nach den §§ 45, 47 JGG
Anwendung von Erwachsenenstrafrecht und Jugendstrafrecht
Welche Vorschriften Anwendung finden, hängt davon ab, in welchem Alter sich der Beschuldigte zur vorgeworfenen Tatzeit befand.
Wann findet das Jugendstrafrecht Anwendung?
War der Beschuldigte zum Zeitpunkt der vorgeworfenen Straftat zwischen 14 und 18 Jahre alt, so finden grundsätzlich das Jugendstrafrecht und damit die §§ 45, 47 JGG Anwendung. Dies ist nur dann nicht der Fall, wenn der Jugendliche nicht als strafrechtlich verantwortlich im Sinne von § 3 S. 1 JGG gilt, weil ihm wegen Reifeverzögerung zum Tatzeitpunkt die notwendige Verstandsreife und Einsichtsfähigkeit fehlte.
Kann das Jugendstrafrecht auch für über 18 Jährige gelten?
Im Alter zwischen 18 und 21 Jahren hingegen kann Erwachsenenstrafrecht anstelle von Jugendstrafrecht Anwendung finden. Der Unterschied besteht darin, dass das Jugendstrafrecht täterorientiert ausgestaltet und deshalb flexibler ist, um pädagogisch sinnvoll auf den noch heranwachsenden Täter einzuwirken.
Dieser Erziehungsgedanke gilt im Erwachsenenstrafrecht nicht. Stattdessen handelt es sich dabei um starres Tatstrafrecht mit weniger Handlungsspielraum.
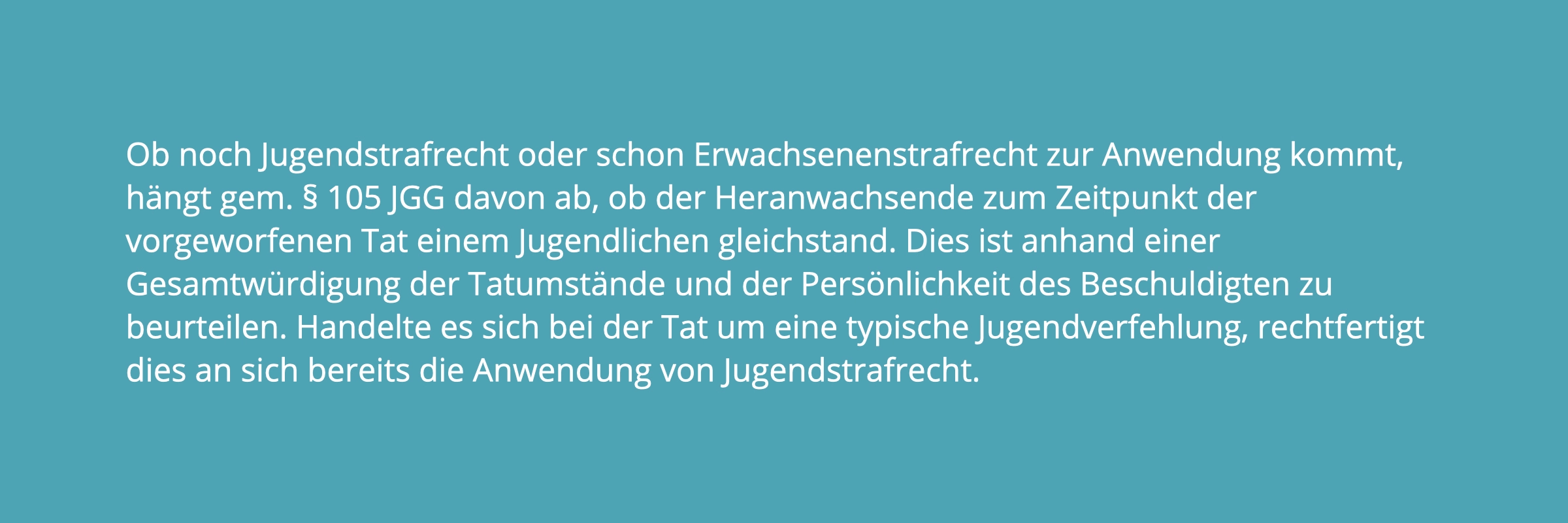
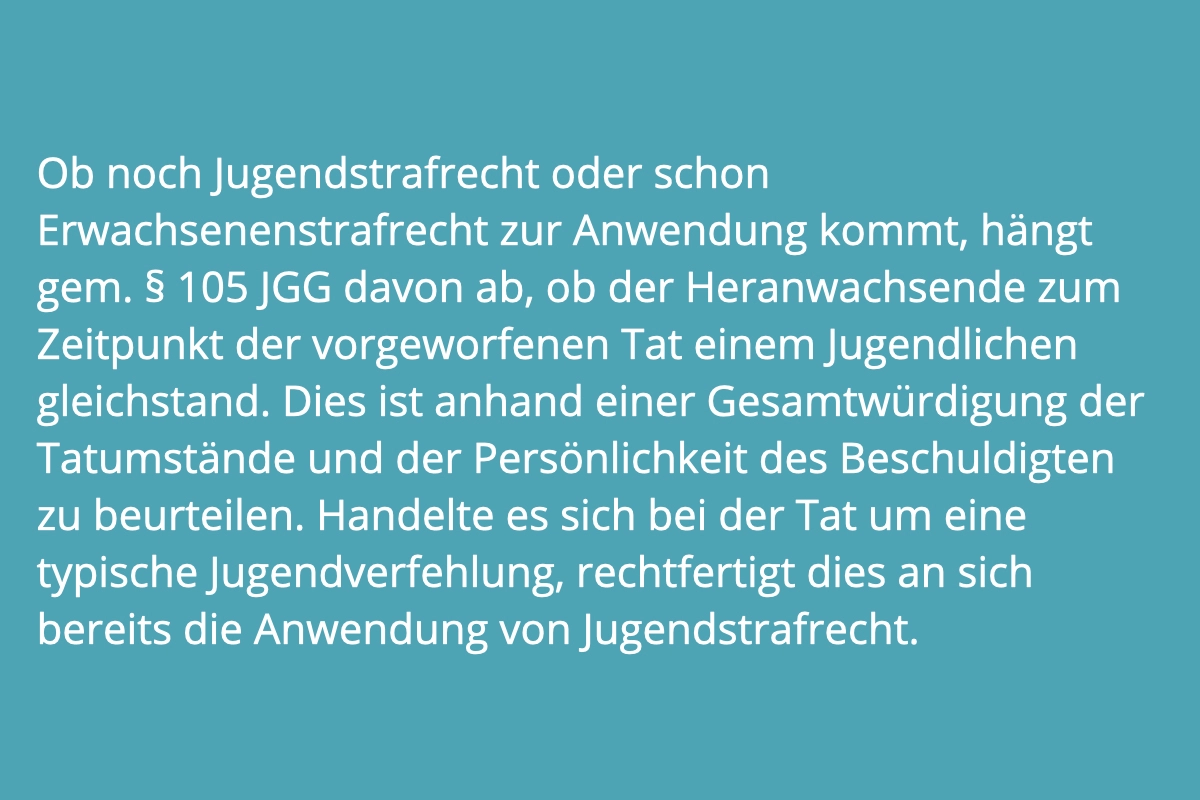
Hat der Beschuldigte im Zeitpunkt der Tatbegehung das 21. Lebensjahr beendet, finden zwingend Erwachsenenstrafrecht und damit bei einer Einstellung des Verfahren aus Opportunitätsgründen die §§ 153 ff. StPO Anwendung.
Wann kommt eine Verfahrenseinstellung aus Opportunitätsgründen in Betracht?
Im Jugendstrafrecht richtet sich die Einstellung aus Opportunitätsgründen grundsätzlich nach § 45 und 47 JGG. Die Staatsanwaltschaft kann zunächst gem. § 45 Abs. 1 JGG von der weiteren Strafverfolgung des jugendlichen oder heranwachsenden Tatverdächtigen absehen, wenn die Voraussetzungen des § 153 StPO vorliegen.
Wann wird ein Verfahren wegen Geringfügigkeit nach § 45 Abs. 1 JGG i.V.m. § 153 Abs. 1 StPO eingestellt?
In Betracht kommt hier beispielsweise eine Einstellung des Verfahrens nach § 45 Abs. 1 JGG in Verbindung mit § 153 Abs. 1 StPO wegen Geringfügigkeit, die bei Jugendlichen und Heranwachsenden anwendbar sind. In diesem Fall kann der Staatsanwalt ohne die Zustimmung des Richters von der Verfolgung absehen, wenn die Schuld des Täters als gering anzusehen ist und kein öffentliches Interesse an der Verfolgung besteht.
In manchen Fällen bedarf es aber der Zustimmung des Gerichts (§ 153 Abs.1 S.2 StPO). ist bereits Anklage erhoben, hat das Gericht gem. § 153 Abs.2 StPO die Möglichkeit unter denselben Voraussetzungen das Verfahren einzustellen.
Eine Einstellung des Verfahrens nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG) wird allerdings ins Erziehungsregister eingetragen, sodass der Rechtsanwalt für Jugendstrafrecht bei Vorliegen der Voraussetzungen die Zustimmung des Richters anregen wird, um so eine Einstellung nach § 153 StPO zu erreichen, die nicht ins Erziehungsregister eingetragen wird.
Der Strafverteidiger für Jugendstrafrecht berät in solchen Fällen den Jugendlichen oder Heranwachsenden über die Folgen einer Einstellung.
Voraussetzung für eine Einstellung nach § 153 Abs. 1 StPO ist, dass es sich bei der Straftat um ein Vergehen (§ 12 Abs. 2 StGB) handelt, also zum Beispiel um eine Sachbeschädigung, einen Diebstahl oder einen Hausfriedensbruch. Des Weiteren muss eine geringe Schuld vorliegen. Dies ist der Fall, wenn eine Strafe im untersten Bereich des in Betracht kommenden Strafrahmens angemessen ist. Bei einem Ladendiebstahl liegt eine geringe Schuld daher zum Beispiel bei der Wegnahme einer Tafel Schokolade vor. Außerdem darf kein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung vorliegen, was beispielsweise dann anzunehmen ist, wenn der Täter einschlägig vorbestraft ist oder durch die Tat schwerwiegende Folgen verursacht hat.
Wann wird ein Verfahren nach § 45 Abs. 2 JGG eingestellt?
Nach § 45 Abs. 2 JGG kann der Staatsanwalt von der Verfolgung absehen, wenn erzieherische Maßnahmen bereits durchgeführt oder eingeleitet wurden oder sich der Jugendliche um einen Ausgleich mit dem Verletzten bemüht (Täter-Opfer-Ausgleich). Der Rechtsanwalt für Jugendstrafrecht regt bei der Staatsanwaltschaft eine solche Einstellung an und berät den Jugendlichen oder Heranwachsenden bezüglich eines Täter-Opfer-Ausgleichs.
Im JGG kommt der Täter-Opfer-Ausgleich auch bei der Erteilung von Weisungen in Betracht, denn nach § 10 Abs. 1 S. 3 Nr. 7 JGG kann der Richter dem Jugendlichen die Weisung erteilen, sich zu bemühen, einen Ausgleich mit dem Verletzten zu erreichen.
Was bedeutet die Erteilung einer Ermahnung, Weisung oder Auflage, § 45 Abs. 3 JGG?
Nach § 45 Abs. 3 JGG kann eine Anklage vermieden werden, wenn der Täter geständig ist und der Staatsanwalt die Anordnung einer Ermahnung, Weisung oder Auflage für erforderlich, die Erhebung einer Anklage aber nicht für geboten, hält. In einem solchen Fall beteiligt der Staatsanwalt den Jugendrichter und regt bei ihm die Erteilung einer bestimmten Maßnahme an.
Solche Weisungen können zum Beispiel das Erbringen von Arbeitsleistung, das Bemühen darum, einen Ausgleich mit dem Verletzen zu erreichen oder die Teilnahme an einem Straßenverkehrsunterricht sein.
Beispiele für Auflagen sind auf der anderen Seite die Schadenswiedergutmachung, die persönliche Entschuldigung oder die Zahlung eines Geldbetrages an eine gemeinnützige Einrichtung.
Vergleichbare Regelung im Erwachsenenstrafrecht: Wann kann ein Jugendstrafverfahren gem. § 153a StPO eingestellt werden?
Wäre die Schuld des Täters eines Vergehens nicht mehr als gering anzusehen, sodass ein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung besteht, gibt es noch die Möglichkeit das
Verfahren gem. § 153a Abs. 1 StPO unter Erteilung von Auflagen oder Weisungen einzustellen. Voraussetzung hierfür ist, dass die Aufgaben- oder Weisungserteilung geeignet ist, das öffentliche Interesse zu kompensieren sowie, dass die vermeintliche Schwere der Schuld des Täters einer solchen Entscheidung nicht entgegensteht.
In der Praxis üblich sind insbesondere die Zahlung von Geldbeträgen zugunsten einer gemeinnützigen Einrichtung oder der Staatskasse oder die Erbringung sonstiger gemeinnütziger Leistungen. Auch die Teilnahme an einem sozialen Trainingskurs kann beauflagt werden.
Vor- und Nachteile einer Einstellung gem. § 153 StPO gegenüber §§ 45,47 JGG
§ 47 Abs. 1 JGG eröffnet dem Jugendgericht nach Anklageerhebung die Möglichkeit das Verfahren mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 153 StPO oder des § 45 Abs. 2 oder 3 JGG entsprechend einzustellen.
In welchem Verhältnis stehen die §§ 153 ff. StPO zu den §§ 45,47 JGG?
Das Verhältnis § 153 StPO und §§ 45, 47 JGG ist umstritten. Wohl überwiegend (LG Aachen NStZ 1991, 450) wird in den §§ 45, 47 JGG abschließende, spezielle Regelungen, gesehen, welche dem allgemeinen Verfahrensrecht und damit auch dem § 153 StPO vorgehen sollen. Aus dem gleichen Grund sei § 153a StPO nicht anwendbar, da die entsprechenden Regelungen aus dem Jugendgerichtsgesetz (§ 45 Abs. 2, 3 und § 47 Abs. 1 Nr. 2, 3 JGG) im Grunde dieselbe Konstellation hinreichend regeln.
Manche Gerichte halten hingegen zumindest § 153 StPO immer dann für unmittelbar anwendbar, wenn dies für den jugendlichen oder heranwachsenden Beschuldigten günstiger sei (LG Itzehoe 23.12.1992 – 9 Qs 167/92).
Dies sei immer dann der Fall, wenn aus erzieherischen Gründen die zwingende Eintragung ins Erziehungsregister nach einer Einstellung gem.§ 45 oder § 47 JGG unterbleiben sollte oder wenn eine Einstellung gem. § 153 StPO umfänglicher möglich sei, etwa weil § 45 Abs. 3 JGG am fehlenden Geständnis des Beschuldigten scheitere.
Hier kommt also der pädagogische Zweck, der vom Jugendstrafrecht verfolgt wird (vgl. § 2 Abs.1 JGG), zum Ausdruck. Danach soll die Anwendung des Jugendstrafrechts vor allem weitere Straftaten eines Jugendlichen oder Heranwachsenden bestmöglich verhindern. Durch eine mögliche Anwendbarkeit der Vorschriften der Strafprozessordnung (§§ 153 ff. StPO), könnten unbillige Ungleichbehandlungen zwischen Erwachsenen (StPO anzuwenden) und Jugendlichen bzw. Heranwachsenden vermieden werden. Dies gelte z.B., wenn die Eintragung ins Erziehungsregister pädagogisch nicht sinnvoll wäre, da deren Stigmatisierungseffekt die Abschreckfunktion im konkreten Einzelfall überwiegen würde (vgl. BeckOK JGG/Schneider, 13. Ed. 1.2.2019, JGG § 45 Rn. 19).
Bei einer Einstellung gem. §§ 45, 47 JGG wäre eine Registereintragung gem. § 60 Abs. 1 Nr. 7 BZRG jedoch zwingend. Bei einer Einstellung gem. § 153 StPO erfolgt hingegen keine Eintragung, was allerdings eine Ungleichbehandlung im Vergleich zu erwachsenen Beschuldigten darstellen kann.
Dafür, dass ausschließlich die Vorschriften des Jugendgerichtsgesetzes angewandt werden spricht allerdings, dass diese gerade dazu geschaffen wurden, den Besonderheiten eines Verfahrens gegen einen jugendlichen (oder heranwachsenden) Beschuldigten gerecht zu werden. Diese Vorschriften regeln für jugendliche (oder heranwachsende) Beschuldigte das (angepasst an die Besonderheiten dieses Verfahrens), was die Regelungen der Strafprozessordnung für erwachsene Beschuldigte regeln.
Unterschiedliche Rechtsfolgen der Einstellungsvorschriften
Qualitativ unterschiedlich sind auch die Rechtsfolgen der §§ 153,153a StPO und §§ 45, 47 JGG.
Wirkung einer Einstellung wegen Geringfügigkeit nach § 153 StPO
Wurde das Verfahren wegen Geringfügigkeit (§ 153 Abs.1 StPO) von der Staatsanwaltschaft eingestellt, kann das Verfahren nach überwiegender Auffassung jederzeit wieder aufgenommen werden, wenn es dafür sachliche Gründe gibt, wie neue Beweise oder das Bekanntwerden weiterer Umstände zur Tat.
Eine gerichtliche Einstellung gem. § 153 Abs. 2 StPO (also eine Einstellung wegen Geringfügigkeit) hingegen führt unstreitig zu einem beschränkten Strafklageverbrauch (BGHSt 48, 331 = NStZ 2004, 218; OLG Jena BeckRS 2015, 05449). Das bedeutet, dass wenn sich der Verdacht dahingehend entwickelt, dass es sich bei der Tat um ein Verbrechen handelt, beispielsweise durch neu aufgetauchte Beweise, kann das Strafverfahren erneut aufgenommen werden. Ansonsten ist eine Wiederaufnahme des Verfahrens aber nicht möglich.
Nach einer rechtskräftigen Sachentscheidung wie einem Urteil oder einem Bußgeldbescheid, kann der Verurteilte hingegen nicht aufgrund derselben Tat, also aufgrund desselben Lebenssachverhalts, erneut strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden, auch dann nicht, wenn sich das vermeintliche Vergehen als Verbrechen darstellt.
Wirkung einer Einstellung nach den §§ 45,47 JGG
Hinsichtlich der Wirkung einer Einstellung gem. § 45 JGG ist zwischen den verschiedenen Konstellationen einer Verfahrenseinstellung zu unterscheiden.
Rechtskraft erlangt die Entscheidung nach § 45 Abs. 1, 2 – also die Einstellung des Verfahrens wegen Geringfügigkeit oder wegen Durchführung erzieherischer Maßnahmen oder einem Täter – Opfer – Ausgleich – nicht. Grundsätzlich kann in diesen Fällen also das Verfahren jederzeit wieder aufgenommen werden, ohne dass dazu neue Tatsachen oder Beweismittel vorliegen müssen (Eisenberg JGG Rn. 31; Böttcher/Weber NStZ 1990, 561 f.).
Wenn der Jugendliche seine ihm erteilten Auflagen und oder Weisungen erfüllt hat, kann die Staatsanwaltschaft nur dann das Verfahren fortsetzen, wenn die Tat im Nachhinein anders (rechtlich) beurteilt werden muss, weil neue Beweise oder neue Tatsachen im Nachhinein aufgetaucht sind. (BGH StraFo 2004, 16; Meyer-Goßner/Schmitt StPO § 153a Rn. 45; Eisenberg JGG § 47 Rn. 24, BeckOK JGG/Schneider, 13. Ed. 1.2.2019, JGG § 45 Rn. 102, 103)
Der gerichtliche Einstellungsbeschluss (gem. § 47 Abs. 1 Nr. 1, S. 5 JGG) ist nach § 47 Abs. 3 JGG beschränkt rechtskraftfähig. Das heißt, dass die Tat grundsätzlich danach nicht mehr wieder verfolgt werden darf, außer es tauchen zum Beispiel neue Beweise auf, die die Wertung der Tat so stark verändern, dass eine neue Entscheidung über die Tat zwingend notwendig ist.
Insoweit ist, anders als bei einer Einstellung nach §§ 153, 153a StPO, bei einer Einstellung gem. §§ 45, 47 JGG, die Wiederaufnahme des Verfahrens bereits dann möglich, wenn nachträglich neue Tatsachen oder Beweismittel zu Tage kommen, welche die Tat rechtlich zwar anders beurteilen lassen, wobei sich diese Tat nicht zwingend dann als Verbrechen darstellen muss.
Welche Verfahrenseinstellung ist für den Beschuldigten am Besten?
Eine Einstellung gem. § 153 StPO ist für den jugendlichen oder heranwachsenden Beschuldigten in der Regel günstiger, denn sie zieht anders als eine Einstellung gem. §§ 45, 47 JGG keine zwingende Eintragung ins Erziehungsregister nach sich. Zudem geht die Rechtsfolge einer gerichtlichen Einstellung gem. § 153 Abs. 2 StPO oder einer staatsanwaltschaftlichen oder gerichtlichen Einstellung gem. § 153a StPO (vgl. § 153a Abs. 1 S. 5 StPO) weiter als die der §§ 45, 47 JGG. Die Wiederaufnahme des Verfahrens ist nach einer Einstellung im Sinne der StPO-Vorschriften ist nämlich nur dann möglich, wenn sich das Vergehen als Verbrechen darstellt. Von dieser Einschränkung wird bei den §§ 45, 47 JGG nicht ausgegangen.
Der Strafverteidiger für Jugendstrafrecht prüft während des Verfahrens, ob die Voraussetzungen für eine Einstellung gegeben sind und berät den Jugendlichen oder Heranwachsenden darüber, wie er zum Beispiel durch den Täter-Opfer-Ausgleich selbst etwas für die mögliche Einstellung tun kann. Er stellt dabei den Kontakt zur Staatsanwaltschaft her und regt die entsprechenden Einstellungsmöglichkeiten an. Die Einstellung des Verfahrens kann auch noch während der Hauptverhandlung erfolgen.
■ IM VIDEO ERKLÄRT:
Vorladung erhalten – Was jetzt zu tun ist:
Aktuelle Beiträge zum Thema Jugendstrafrecht
Keine Ergebnisse gefunden
Die angefragte Seite konnte nicht gefunden werden. Verfeinern Sie Ihre Suche oder verwenden Sie die Navigation oben, um den Beitrag zu finden.
Nehmen Sie jetzt Kontakt zum Anwalt Ihres Vertrauens auf
Wenden Sie sich für weitere Fragen gerne an unsere Kanzlei und vereinbaren Sie einen Beratungstermin per Telefon, per Videoanruf oder direkt vor Ort. Wir stehen Ihnen effizient mit jahrelanger Expertise zur Verfügung.












