Umgang mit Presseanfragen:
Anwalt Reputationsmanagement
YouTube - Kanal
der BUSE HERZ GRUNST Rechtsanwälte
Medienauftritte
der BUSE HERZ GRUNST Rechtsanwälte





Podcast - Anwaltsprechstunde
der BUSE HERZ GRUNST Rechtsanwälte
Medienauftritte






Nicht selten werden Behörden, Unternehmen oder prominente Personen ohne Vorwarnung mit Presseanfragen konfrontiert, die teilweise erhebliche Vorwürfe enthalten. Dabei setzen die Journalisten kurze Fristen, die einen hohen Zeitdruck erzeugen. Es gilt , in kürzester Zeit die richtige Kommunikationsstrategie zu wählen. Denn ist über einen bestimmten Verdacht, z.B. über eine Straftat, erst einmal berichtet worden, lässt sich die Schädigung des Image – schlimmstenfalls eine Welle an negativen Meinungen, gar ein Shitstorm, der auf den Betroffenen einprasselt – nur schwer wieder aus der Welt schaffen. Gerade bei einer Tätigkeit im Social Media Bereich als Influencer beispielsweise kann ein solcher Verlust der Reputation und Vertrauen der Follower zu erheblichen Einbußen führen, sodass ein gutes Reputationsmanagement von essentieller Bedeutung sein kann. Gleiches gilt, wenn die Reputation einer Marke auf dem Spiel steht und somit ein schlechter Ruf und der Verlust von Kunden droht. Gerade dann empfiehlt es sich, sich im Falle einer Medienanfrage an einen spezialisierten Rechtsanwalt für Medienrecht und Presserecht zu wenden.
Im Folgenden haben wir Ihnen einige Tipps zum Thema Reputationsmanagement, inklusive Online-Reputationsmanagement zusammengestellt, sollten Sie mit einer entsprechenden Anfrage von den Medien konfrontiert sein.
■ IM VIDEO ERKLÄRT:
Umgang mit Presseanfragen: Tipps vom Anwalt für Medien- und Presserecht
Warum fragt die Presse an? Umgang mit Presseanfragen
Im Rahmen ihrer Recherchetätigkeit bedienen sich die Medien oftmals unterschiedlicher Quellen zur Informationsgewinnung. Eine wichtige Rolle für die Sachverhaltsaufklärung spielen dabei Presseanfragen gegenüber den betroffenen Unternehmen, Privatpersonen oder staatlichen Stellen.
Anfrage der Medien im Bereich Verdachtsberichterstattung
Möchte eine Zeitung, ein TV-Format/ Fernsehsender oder ein investigativer Journalist über einen Verdacht, eine angebliche Verfehlung oder gar über ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren berichten, müssen dabei die so genannten Grundsätze der zulässigen Verdachtsberichterstattung eingehalten werden. Eine wichtige Voraussetzung ist dabei, dass die Vertreter der Medien vor der Veröffentlichung des Vorwurfs bzw. des Strafvorwurfs sich um Kommunikation mit dem Betroffenen bemühen und um eine Stellungnahme zu bitten haben. Diese so genannte Konfrontationspflicht ist nach höchstrichterlicher Rechtsprechung zwingend zu beachten, da nur so der Betroffene im Rahmen der Waffengleichheit die Chance hat, in der mutmaßlich anprangernden Berichterstattung seine Sicht der Dinge zum Ausdruck zu bringen.
Dabei haben die Medienvertreter für die Beantwortung der Presseanfrage auch eine angemessene Frist zu setzen. Je schwerwiegender die Äußerungen das Persönlichkeitsrecht/ Unternehmenspersönlichkeitsrecht beeinträchtigen, desto höhere Anforderungen sind an die Angemessenheit der gesetzten Frist zu stellen.
Wenn die Frist unangemessen kurz ist, ist es ratsam, um eine Fristverlängerung bei dem anfragenden Journalisten zu bitten. Falls der Journalist der Bitte um Fristverlängerung nicht nachkommen kann, ist dies dem Betroffenen mitzuteilen und zudem anzugeben, bis wann nach Fristablauf die Stellungnahme noch Berücksichtigung finden kann (dazu BGH NJW 2022, 1751).
Umgang mit Presseanfragen gegenüber Privaten und Unternehmen
Für die Beurteilung einer Auskunftspflicht auf eine Presseanfrage ist essentiell, an wen sich das Auskunftsverlangen richtet. Sind von dem Auskunftsersuchen Private oder Unternehmen (z.B. in Bezug auf eine Marke) betroffen, kann eine Angabe entsprechender Informationen (rechtlich) verweigert werden. Auf Unternehmen, die in öffentlicher Hand stehen oder überwiegend von dieser beherrscht werden bzw. Aufgaben der Daseinsvorsorge übernehmen, wird später eingegangen, da hier Ausnahmen von diesem Grundsatz bestehen.
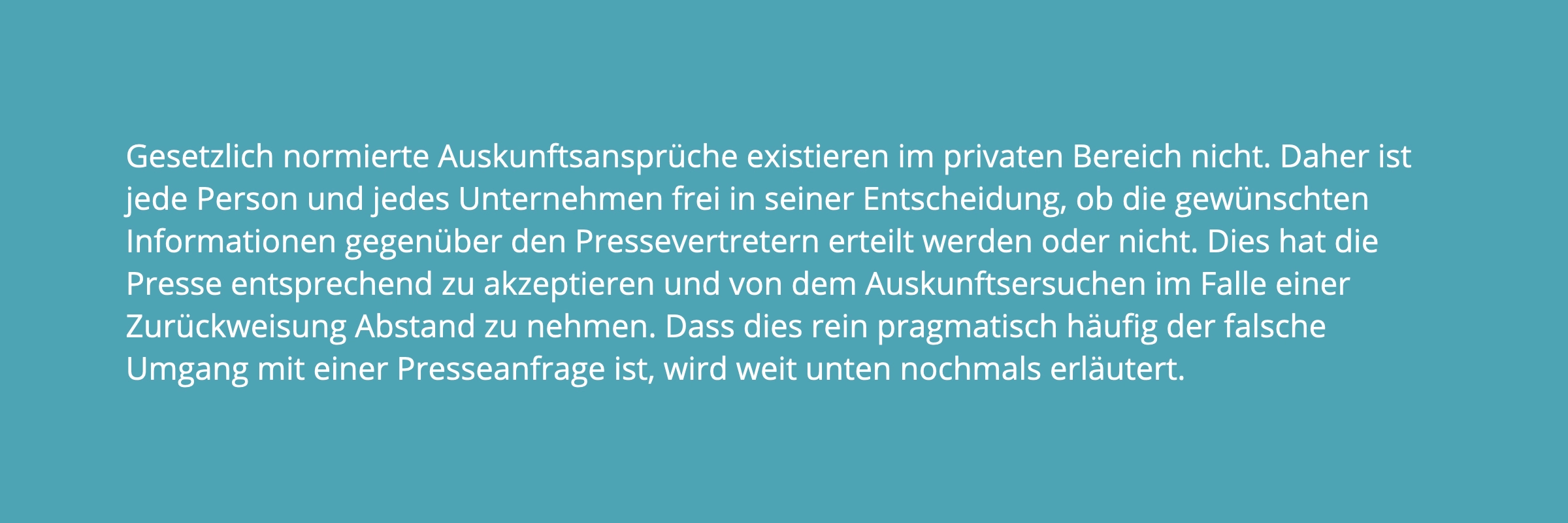
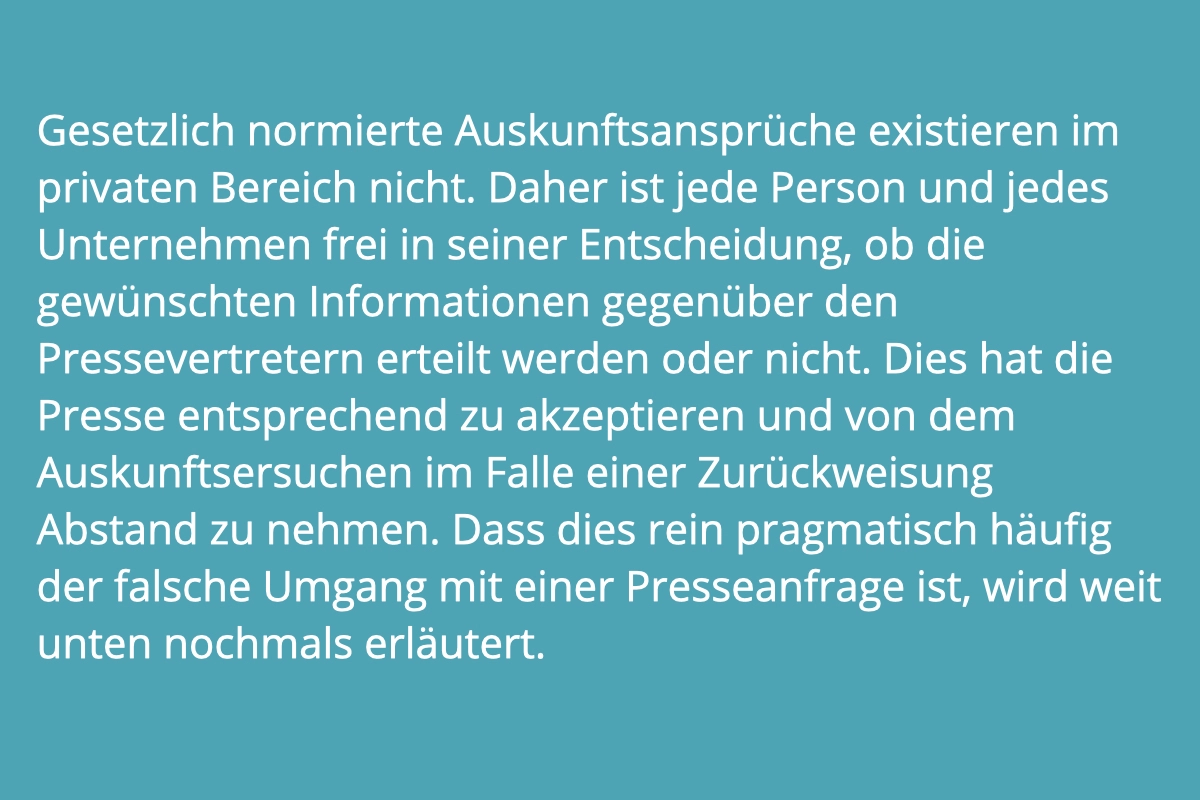
Gelten Besonderheiten bei Presseanfragen an prominente Personen?
Dieser Grundsatz gilt sowohl für den „Normal-Bürger“ als auch für prominente Personen. Verweigerungsrechte stehen ebenso Prominenten ungeachtet der Intensität ihres öffentlichen Auftretens (z.B. auf Social Media) zu. Unterschiede finden sich erst im Bereich der Berichterstattung. Verweigert eine prominente Persönlichkeit eine Stellungnahme, kann die Berichterstattung trotz Defiziten in der Recherche möglicherweise dennoch zulässig sein, weil bereits an der Person an sich ein überragend öffentliches Interesse besteht.
Denkbar wäre eine Auskunftspflicht allenfalls bei Unternehmen im Hinblick auf die Problematik der mittelbaren Drittwirkung von Grundrechten unter Privaten und dem Willkürverbot aus Art. 3 GG. Wird ein einzelner Journalist beispielsweise ohne sachlichen Grund von der Informationsweitergabe ausgeschlossen, kann ein Verstoß gegen Art. 3 GG zu prüfen sein. Ob dieser tatsächlich gegeben ist, kann jedoch nicht pauschal beantwortet werden, sondern ist immer anhand des konkreten Einzelfalls zu überprüfen.

© Max Woyack
Presseanfragen gegenüber staatlichen Stellen
Anders als im privaten Bereich kann die Informationsfreigabe von Behörden oder anderen Trägern öffentlicher Gewalt nicht von deren Wohlwollen abhängen. Grund hierfür ist, dass das Medium Presse als Kontroll- und Aufklärungsinstitution schlichtweg nicht funktionieren würde, wenn Recherche lediglich aus der Verarbeitung bereits veröffentlichter Informationen bestehen würde. Es existieren daher verschiedene Herleitungen und Anspruchsgrundlagen, die der Presse Auskunftsrechte zugestehen.
Auskunftsanspruch aus den Landespressegesetzen
Die Landespressegesetze vermitteln den Pressevertretern umfangreiche Ansprüche im Hinblick auf ein bestimmtes Auskunftsersuchen. So bestimmt beispielsweise § 4 Abs. 1 BlnPrG: „Die Behörden sind verpflichtet, den Vertretern der Presse, die sich als solche ausweisen, zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgabe Auskünfte zu erteilen.“
Anspruchsberechtigte im Sinne der Vorschrift sind all diejenigen Personen und Unternehmen, die an der öffentlichen Aufgabe der Ermittlung und Verbreitung von Nachrichten mitwirken, dazu Stellung beziehen, Kritik üben oder auf andere Weise an der Meinungsbildung teilnehmen (vgl. MAH UrhG / Hertel § 16 Rn 22; Löffer/Burkhardt LPG § 4 Rn. 42). Nach ständiger Rechtsprechung des BVerfG kann es für die Beurteilung der Presseeigenschaft jedenfalls nicht auf eine bestimmte Seriosität des Mediums ankommen, da die Pressefreiheit nicht auf seriöse Pressevertreter beschränkt sei (vgl. BVerfG, Beschluss vom 25-01-1984 – 1 BvR 272/81, NJW 1984, 1741, beck-online). Einzelne Pressevertreter dürfen gegenüber ihren Mitbewerbern auch nicht bevorzugt behandelt werden (vgl. § 4 Abs. 3 BlnPrG).
Der Begriff „Behörde“ als tauglicher Anspruchsgegner im Sinne der Landespressegesetze kann insoweit missverstanden werden, da nicht nur Behörden im klassischen Sinne diesem unterfallen. Er ist wesentlich umfassender zu verstehen und schließt z.B auch Parlamente und deren Verwaltungen mit ein. Wie bereits oben angedeutet , können selbst privatrechtliche Organisationen oder Unternehmen als Behörde anzusehen sein. Voraussetzung ist dabei aber stets, dass sie Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge im Auftrag der öffentlichen Hand übernehmen und/oder von der öffentlichen Hand beherrscht werden (vgl. BGH, Urteil vom 10. 2. 2005 – III ZR 294/04, NJW 2005, 1720, beck-online).
Auskunftsersuchen gegenüber Bundesbehörden können nicht auf die Landespressegesetze gestützt werden, vgl. BVerwG, NVwZ 2013, 1006).
Die Auskunftspflicht erstreckt sich grundsätzlich auf die Beantwortung konkreter Fragen, die sich auf Tatsachen beziehen. Ein Akteneinsichtsrecht oder gar die Übermittlung des Akteninhalts in Kopie vermitteln Auskunftsansprüche nach den Landespressegesetzen nicht (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, Beschl. v. 7.3.2014, NVwZ 2014, 1177, beck-online).
Achtung: Von dieser Pflicht zur Preisgabe von Informationen gibt es aber auch Ausnahmen. Etwa § 4 BlnPrG normiert im 2. Absatz entsprechende Ausnahmetatbestände, wie beispielsweise das Entgegenstehen von Geheimhaltungsvorschriften oder die Verletzung schutzwürdiger privater Interessen (z.B. das allgemeine Persönlichkeitsrecht der von der Presseanfrage Betroffenen).
Das OVG Saarlouis argumentierte in einer Entscheidung aus dem Jahre 2007 (vgl. OVG Saarlouis, Beschluss vom 27. 6. 2007 – 3 Q 164/06, NJW 2008, 777) in Bezug auf das Ausforschen innerer Tatsachen, dass dem die „zu schützende[…] Persönlichkeitssphäre der Betroffenen“ entgegenstehe und hierdurch „nach der Rechtsprechung des BVerfG der Schutzbereich der Presse-, Rundfunk- und Informationsfreiheit überschritten wird.“
© D. Schmidt
Auskunftsanspruch aus dem Informationsfreiheitsgesetz
Nach § 1 Abs. 1 S. 1 IFG hat jeder nach Maßgabe des IFG gegenüber den Behörden des Bundes einen Anspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen.
Eine Besonderheit zu den Auskunftsansprüchen der Landespressegesetze besteht zunächst darin, dass grundsätzlich jedermann Auskunft von den Behörden verlangen kann. Auch in diesem Zusammenhang ist der Behördenbegriff weit zu interpretieren. § 1 Abs. 1 S. 3 IFG enthält insoweit den Zusatz, dass einer Behörde eine natürliche Person oder eine juristische Person des Privatrechts gleichsteht, soweit eine Behörde sich dieser zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben bedient.
Unter Umständen kann es für die Pressevertreter von Vorteil sein, sich auf den Auskunftsanspruch aus dem IFG zu stützen. Zwar benötigen die Anfragen nach dem IFG in der Regel eine längere Bearbeitungszeit (vgl. MAH UrhG / Hertel § 16 Rn 28). Hierüber wird jedoch ein vollständiges Akteneinsichtsrecht und gegebenenfalls auch einen Anspruch auf Übersendung der Akten in Kopie gewährt.
Der Informationsanspruch ist, wie der zuvor genannte presserechtliche Auskunftsanspruch, jedoch nicht schrankenlos gewährleistet. Ausnahmetatbestände finden sich in den §§ 3 bis 6 IFG. So kann der Informationszugang zum Schutz von besonderen öffentlichen Belangen (z.B. innere und äußere Sicherheit, Durchführung eines laufenden Gerichtsverfahrens), zum Schutz des behördlichen Entscheidungsprozesses (z.B. kein Einblick in Entwurfsentscheidungen), zum Schutz personenbezogener Daten sowie zum Schutz des geistigen Eigentums und von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen (nur zulässig mit Einwilligung des Betroffenen) verweigert werden. Als Ausnahmetatbestände sind die Voraussetzungen restriktiv auszulegen. Es wird im Einzelfall und gegebenenfalls unter Hinzuziehung anwaltlicher Hilfe genauestens zu prüfen sein, ob das Auskunftsersuchen oder der Antrag auf Akteneinsicht aus den genannten Gründen abgelehnt werden kann.
Der presserechtliche Auskunftsanspruch und der Informationsanspruch aus dem IFG können auch nebeneinander angewandt werden.
Mittlerweile verfügen die meisten Bundesländer über ein eigenes Informationsfreiheitsgesetz.

© Adobe Stock Foto
Auskunftsanspruch aus dem Grundgesetz
Ist den Medien beispielsweise gegenüber Bundesbehörden ein Vorgehen nach den Landespressegesetzen verwehrt, ist nach ständiger Rechtsprechung des BVerwG ein Auskunftsanspruch unmittelbar aus den Grundrechten, nämlich Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG, ableitbar. Danach verleihe das Grundrecht der Pressefreiheit Presseangehörigen einen verfassungsunmittelbaren Anspruch auf Auskunft gegenüber Bundesbehörden in Ermangelung einer einfachgesetzlichen Regelung des Bundesgesetzgebers. Hier müssen dann das Informationsinteresse seitens der Presse und den diesem entgegenstehenden Interessen im Einzelfall abgewogen werden. Vgl. BVerwG, Beschl. v. 11.4.2018 – 6 VR 1/18, NVwZ 2018, 902, beck-online).
In der zitierten Entscheidung wurde der Presse gegenüber dem Bundesnachrichtendienst (BND) ein Auskunftsanspruch im Hinblick auf rein statistische Informationen (wie z.B. die Mitteilung der Anzahl der Strafverfahren gg. Mitarbeiter des BND wegen Verletzung des Dienstgeheimnisses (§ 353 b StGB)) zu gebilligt. Allerdings wurde dieser wiederum verneint, wenn es darum geht, dass solche Anfragen in regelmäßigen Zeitabständen wiederholt werden oder die Fragen sich auf konkrete Angaben zu Strafverfahren beziehen. In diesem Zusammenhang bestehe nach Auffassung des BVerwG ein berechtigtes Geheimhaltungsinteresse des BND (vgl. BVerwG, Beschl. v. 11.4.2018 – 6 VR 1/18, NVwZ 2018, 902, beck-online). Auch hier zeigt sich, dass es stets einer konkreten Einzelfallprüfung bedarf, um festzustellen, ob ein Auskunftsersuchen zulässig ist und damit beantwortet werden muss.
Auskunftsanspruch aus der Europäischen Menschenrechtskonvention
Schließlich gesteht auch der EGMR der Presse einen unmittelbaren Auskunftsanspruch in bestimmten Konstellationen aus Art. 10 EMRK zu. Danach könne ein solches Recht unter anderem dann entstehen, wenn der Zugang zur Information für die Ausübung des Rechts auf Freiheit der Meinungsäußerung unabdingbar ist, insbesondere für „die Freiheit, Informationen zu empfangen und weiterzugeben“, und wenn die Ablehnung des Zugangs ein Eingriff in die Ausübung dieses Rechts ist (vgl. EGMR (Große Kammer), Urt. v. 8.11.2016 – 18030/11 (Magyar Helsinki Bizottság/Ungarn), NVwZ 2017, 1843, beck-online).
© Pexels
Wie ist die richtige Strategie im Umgang mit Presseanfragen?
Dieser rechtliche Anspruch von Pressevertretern auf Beantwortung ihrer Fragen gegenüber Behörden im Rahmen einer Presseanfrage gilt im Verhältnis zu Privatpersonen, Unternehmen oder Prominenten in aller Regel nicht.
Sollte ich auf eine Anfrage der Medien überhaupt reagieren?
Dennoch ist im Rahmen eines effektiven Krisenmanagements eine Stellungnahme zu der Medienanfrage häufig sinnvoll, wenn nicht sogar zwingend erforderlich. Es besteht somit die Möglichkeit, frühzeitig Einfluss auf eine zu erwartende Berichterstattung und den damit einhergehenden „guten oder schlechten“ Ruf seiner selbst zu nehmen. Die Organisation von präventiven Maßnahmen und die zielführende Kommunikation mit Journalisten sind gerade im Presse- und Äußerungsrecht äußerst wichtig, da im Fall einer rufschädigenden Berichterstattung – auch wenn sie rechtswidrig war und dagegen vorgegangen wird – häufig etwas im Gedächtnis der Gesellschaft inkl. Kunden und potentiellen Kunden hängen bleibt. Skandale vermarkten sich besser und „gehen“ schnell viral, als spätere Richtigstellungen, Widerrufe oder positive (Unternehmens-)Nachrichten. Den „guten Ruf“ wiederherzustellen kann sich dann mitunter schwierig gestalten.
Allgemein kann man im Umgang mit der Presse bei einer Presseanfrage zwei Methoden unterscheiden, die je nach Sachlage zur Anwendung kommen können:
- Methode 1: ausführliche Stellungnahme und/ oder Gespräch mit dem Journalisten,
- Methode 2: knappe Antwort unter Zurückweisung der erhobenen Vorwürfe.
Überhaupt nicht auf eine Anfrage der Presse zu reagieren, wird von unserer Kanzlei nicht als zielführend betrachtet und im Rahmen unserer Mandatsarbeit nicht praktiziert. In diesem Fall würde dem betroffenen Mandanten jegliche Möglichkeit genommen, die drohende Berichterstattung positiv zu beeinflussen, abzumildern oder im besten Fall gar zu verhindern.
Ob Methode 1 oder 2 zur Anwendung kommt, hängt maßgeblich von den erhobenen Vorwürfen ab und muss in jeden Einzelfall sorgfältig abgewogen werden.
Wird im Rahmen eines strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens eine Stellungnahme vom Betroffenen eingeholt, ist eine zurückhaltende Antwort in der Sache, jedoch eine ausführliche rechtliche Stellungnahme zu einer unzulässigen identifizierenden Berichterstattung im Rahmen der drohenden Verdachtsberichterstattung angezeigt. Hier ist es besonders wichtig, dass sich Ihr Medienanwalt mit Ihrem Strafverteidiger abstimmt.
Wir haben in unserer Kanzlei sowohl Fachanwälte für Medienrecht als auch für Strafrecht, so dass wir Sie vollumfänglich und aus einer Hand vertreten können.
Gleiches gilt für den Fall, dass eine Berichterstattung über einen Sachverhalt droht, der die Privat- oder Intimsphäre des Betroffenen verletzt. In diesem Fall sollte bereits im Rahmen der Antwort auf die Presseanfrage ausdrücklich auf einen drohender rechtswidrigen Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung aus Art. 2 Abs. 1, 1 Abs. 1 GG hingewiesen und offensiv gerichtliche Maßnahmen, insbesondere auch die Geltendmachung eines Geldentschädigungsanspruchs, angedroht werden, falls es zu einer solchen Berichterstattung kommt.
© Adobe Stock Foto
Welche konkreten Maßnahmen sind bei einer Presseanfrage zu beachten?
Wenn die Geschäftsführung Ihres Unternehmens, Ihre Behörde oder Sie als Einzelperson eine kritische Anfrage durch die Presse erhalten haben, sollten Sie am Besten bedacht und planmäßig an die Medienanfrage herangehen.
8 Tipps zum Umgang mit einer Anfrage der Medien vom Rechtsanwalt für Medienrecht:
- 1. Ruhe bewahren! Keine übereilte Antwort. Besser keine Reaktion als die falsche
- 2. Absenders der Presseanfrage überprüfen. Sicherstellen, dass es sich tatsächlich um eine (seriöse) Presseanfrage handelt (Stichwort: „never feed the trolls!“)
- 3. Interne Aufklärung des Sachverhalts bzw. Befragung der beteiligten Personen/ Entscheidungsträger
- 4. Prüfung der Frage, ob eine rechtliche Pflicht zur Antwort besteht
- 5. Entscheidung, ob Methode 1 oder 2 gewählt wird
- 6. Formulierung einer Antwort. Festlegung, wer der Absender der Antwort sein soll
- 7. Sorgfältige Prüfung der anschließenden Berichterstattung
- 8. Ggf. anschließende anwaltliche Abmahnung, gerichtliche (Eil-)-Maßnahmen
Unsere Fachanwälte für Medien- und Strafrecht helfen in der Krise
Ihr Unternehmen, Ihre Behörde oder Sie persönlich haben eine Presseanfrage erhalten und benötigen dringend anwaltliche Hilfe? Auch wenn Sie Influencer / Content-Creator sind und es gegebenenfalls um das Schicksal Ihrer Social Media Kanäle geht, stehen wir Ihnen bei der Geltendmachung Ihrer Rechte anwaltlich zur Seite.
Unsere Fachanwälte für Medienrecht und Strafrecht sind Experten im Umgang mit der Presse und stehen Ihnen kurzfristig im Rahmen eines effektiven Krisenmanagements und zur bestmöglichen Wahrung Ihrer Reputation im Rahmen eines Reputationsmanagements und Online-Reputationsmanagements bundesweit zur Seite.
Nehmen Sie jetzt Kontakt zum Anwalt Ihres Vertrauens auf
Wenden Sie sich für weitere Fragen gerne an unsere Kanzlei und vereinbaren einen Beratungstermin per Telefon, per Videoanruf oder vor Ort in Berlin, Hamburg und München.













